Viacheslaw Gromov von Aitad im Interview
Embedded KI richtig in Medizintechnik integrieren
»Die Magie liegt in den ungenutzten Daten«, sagt Viacheslav Gromov, CEO des KI-Entwicklers Aitad. Im Interview gibt er einen Überblick zu aktuellen KI-Trends, Hürden wie dem AI Act und hilfreichen KI-Tools für Entwickler intelligenter Medizintechnik.
Herr Gromov, von Mega-Chips bis zu GenKI – welche KI-Entwicklungen sind für Medizingeräte derzeit am relevantesten?
Es liegt auf der Hand, dass rechenstarke Prozessoren und die generative künstliche Intelligenz sowohl die Medizinforschung als auch die Entwicklung von Medizingeräten beschleunigen. Gerade in diesem Jahr haben wir durch globale KI-Erfolge so viel Akzeptanz sowie Interesse in der Wirtschaft und Gesellschaft wie noch nie. Und gleichzeitig werden besonders im Embedded-Bereich die Grundlagen – also KI-optimierte Halbleiter wie beispielsweise der kürzlich vorgestellte NXP i.MX93 mit der Arm-Ethos-U65-NPU oder der Renesas RZ/V2H mit dem eigenen DRP-AI3-Beschleuniger, um nur die Flaggschiffe zu nennen – immer performanter und marktfähiger.
Die typischen technischen und nichttechnischen Technologiekurven treffen sich also gerade – was künstliche Intelligenz im Produkt und gerade auch in der Medizintechnik durch besondere Sicherheits- und Effizienzanforderungen so spannend und greifbar wie noch nie macht.
Edge versus Embedded – wie ist das Verhältnis derzeit und wann macht welcher Ansatz Sinn? Wie schaut es perspektivisch aus?
Edge AI betrachten wir als die Cloud-nähere Technologie – ein Teil der Datenverarbeitung findet zentral auf größeren Rechenressourcen statt. Bei Embedded-KI geht es darum, gänzlich abgekoppelt und autark die Analysen, Voraussagen und Entscheidungen zu treffen, da die Datenarbeit rein lokal unter hohen Datenmengen und in Echtzeit stattfindet.
Die Nutzung ist davon abhängig, wie schnell (Echtzeitfähigkeit) und tief (Datentiefe vor Ort) sowie privatsphärengerecht die Daten verarbeitet werden müssen. Es gibt Anwendungen, die mit geringeren Datenmengen, dafür aber von einigen Devices sinnvoller sind. Und es gibt solche, die schon allein aus Akzeptanz- oder Zulassungsgründen autark sein müssen, wie das oft in der Medizintechnik der Fall ist.
Wir glauben an die symbiotische Koexistenz zwischen Cloud, Embedded-KI und allem dazwischen. Wobei sich sicherlich die Technologieränder verschieben werden, da Medizingerätehersteller sich mehr und mehr für dezentrale KI interessieren.

Worauf sollten Medizingeräteentwickler bei der Integration von Embedded-KI besonders achten?
Neben dem Nutzen für Ärzte und Patienten braucht es neben der großen Vision vor allem praktikable Entwicklungsschritte. Proof-of-Concepts einzelner Systemkomponenten wie beispielsweise intelligenter Embedded-KI-Sensorik können ein guter Startpunkt sein und auch für die nötige Akzeptanz beim Management sorgen.
Was bei der Komponentenauswahl nach Performance oft vergessen wird: Gerade bei batteriebetriebenen Medizingeräten mit einer NPU-Peripherieeinheit ist trotz hoher Effizienz der Energieverbrauch nicht zu vernachlässigen und im Design zu berücksichtigen.
Und last but not least: Für die grundlegende Entwicklung sollten sich Firmen zu einem gesunden Teil zunächst von den regulatorischen Lasten frei machen. KI entwickelt sich aktuell so schnell, die Regulatorik zieht mit einer gewissen Latenz hinterher.

Was sollten MedTech-Entwickler unbedingt evaluiert haben, bevor sie loslegen?
Hersteller sollten zunächst ihren Fokus auf ihre Kernkompetenzen legen. Wo kann die vorhandene Produkttechnologie sinnvoll mit lokaler Embedded-KI weiter ausgebaut werden? Das kann etwa eine Optimierung von bestehenden Medizingeräten mit besserer Bedienung oder Fehlerfallintelligenz sein – diese Funktionen könnten auch neue Umsatzströme generieren. Dazu kommt, dass sowohl Sicherheit wie auch Fachkräftemangel solche Funktionen fast notwendig machen.
Das Entwicklerteam muss also analysieren: Welche Daten und Sensorik nutzen wir schon heute? Die Magie liegt in den Daten, welche bisher kaum nutzbar waren und die jetzt mit neuen Mitteln wie Embedded-KI neu evaluiert werden können.
Künstliche Intelligenz darf aber meiner Auffassung nach nicht zum Selbstzweck integriert werden. Lieber mit einer Systemergänzung anfangen – also zum Beispiel einer Embedded-KI-Funktionalität am vorhandenen Datenbus, als gänzlich neue Geräte mit KI zu entwickeln. Dieses Vorgehen bringt Erfahrung und konditioniert den Markt.
Was sind häufige Fallstricke und wie lassen sie sich vermeiden?
Zunächst überschätzen unsere Kunden oft ihren Datenbestand. Zielbefreit gesammelte Daten sind oft eher Datenmüll als Datenschatz und die schiere Menge hat nichts mit dem Informationsgehalt zu tun. Für die KI ist entscheidend, welche Daten wofür, in welcher Auflösung, mit welcher zeitlichen Korrelation und mit welchen Labeln gesammelt wurden. Entwickler müssen in mehreren Stufen durchdenken, welche Daten sie wollen und was die Erkenntnis sein könnte.
Zudem denken viele Entscheider und Entwickler sehr zentral – sowohl innerhalb des Medizingerätes als auch im Umfeld –, z. B. an leistungsfähige Zentralrechner oder die Cloud. Am effektivsten sind Prozesse aber meist, wenn sie symbiotisch verteilt und auch lokal ambivalent passieren. Auch bei Use Cases denken viele zu sehr innerhalb der herkömmlichen »Box« – mit KI können jedoch viel komplexere Zusammenhänge abgeschöpft werden, zum Beispiel: Warum sollte man einen Instrumentenprozess nicht auch an den Partikeln in der Luft oder durch Spektrografie im Desinfektions- oder Kühlmedium überwachen und optimieren können?
Und zuletzt kommt noch das Phänomen, dass Entwickler oft nur in ellenlangen Chip-Listen, Anforderungslisten und gleich an die oft mit großen Mühen verbundene Zulassung denken – das erstickt so manche Entwicklung im Keim, ohne dass sich ihr Potenzial für die Zukunft zeigt.
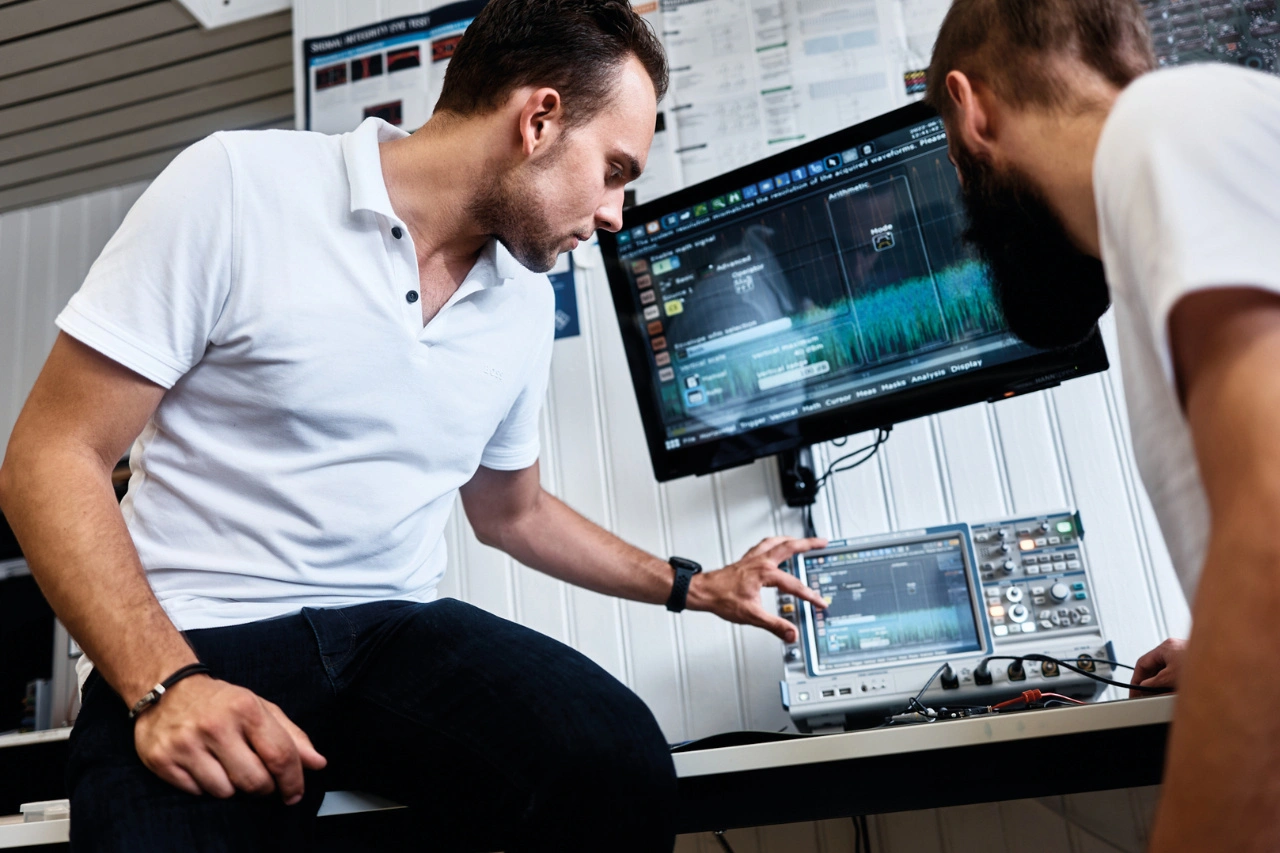
Wie viel Zeit sollten MedTech-Entwickler für »KI ins Produkt« ansetzen?
Bis zu einem serienreifen Prototyp können bei produktspezifischen Projekten wie einer Zahnstatuserkennung, Nutzeranalyse am Bedienteil eines Medizingerätes oder Situationserkennung im Krankenhaus schon einige Jahre vergehen. Das ist stark von der Datenakquise bzw. dem Zugang zu Realdaten durch kooperierende Kliniken, Pflegeeinrichtungen oder neuerdings Test-Krankenhausstationen mit entsprechender Infrastruktur abhängig.
Sind es einfachere User-Interaction-Themen wie Personendetektion, Gesten, Sprache und Objekterkennung oder nachbildbare Verschleißüberwachungen wie Predictive/Preventive Maintenance von Werkzeugen und Gerätebestandteilen, kann man dies weitgehend abgekoppelt von medizinischem Alltag tun, sodass sich die Prototypenentwicklung auf bis zu sechs Monate verkürzt. Sind schon Basisdaten aus bestehenden Datenbanken vorhanden, kann man die Zeit noch einmal deutlich verkürzen. Die Serialisierung und damit auch die Anpassung an die Regulatorik ist wiederum eine andere Sache, abhängig von Markteintrittsland und Device.
Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach der AI Act in Kombi mit der MDR?
Bei manchen Punkten, vor allem bei Definitionen und Bewertungsmethoden, besteht derzeit noch die Gefahr des Widerspruchs der beiden Regularien. Das könnte für Medizingerätehersteller die KI-Integration bzw. die Argumentation schwerer oder noch umfangreicher machen. Aber das wird sich erst ja noch in der nationalen Umsetzung des EU AI Acts spiegeln. Diesbezüglich ist die gute Nachricht, dass Embedded-KI-Systeme als meist kleinere, diskriminative Modelle von der kritischen Risikoeinordnung weitgehend unbetroffen sind.
Grundsätzlich sind die Vorentwicklungen im Rahmen der regulatorischen Sandboxes, wie im AI Act angedacht, gerade für die schnell iterierende KI-Grundlagentechnologie sinnvoll, und meiner Meinung nach sollte das Konzept sogar ausgeweitet werden. Gerade für den Medizinmarkt muss eine passende KI-Haftungsregulierung dringend praktikabel eingeführt werden, das ist oft noch ein offenes Feld.
Wie steht es um die Nutzung von KI als Tool in der medizinischen Softwareentwicklung?
Der Fortschritt ist gerade enorm. Das bekannteste Tool für Entwickler ist wohl der GitHub Copilot. Jeder Medizintechniker kann jetzt entscheiden, ob das Selberschreiben oder aber das Überprüfen von generiertem KI-Code effizienter für ihn ist.
Ziemlich interessant sind auch aktuelle Tools wie Voltai oder Embedd, die Application Notes und Datenblätter von Bauteilen auswerten und darauf aufbauend Fragen beantworten, wichtigste Eigenschaften oder gar Designvorschläge geben. Das kann je nach Prozess viel Zeit in der Entwicklung sparen.

Was wird in den nächsten Monaten für die Entwicklung medizinischer KI-Produkte wichtig werden?
Die aktuellen Bemühungen um das Gesundheitsdaten-Nutzungsgesetz werden die Türen für Medizin-KI und eine verbesserte Forschung und Entwicklung öffnen. Dann wären entsprechend pseudonymisierte Gesundheitsdaten in einfacherer und umfangreicherer Form für die R&D-Abteilungen in Medizintechnikunternehmen verfügbar. Ich glaube auch, dass der EU AI Act trotz der offenen Fragen eine Blaupause für weitere Regulatorik sein wird (z. B. mit der Risikoeinstufung) – das könnte die Zukunft von KI in der Medizin wesentlich beeinflussen, hin zu mehr Standardisierung und Sicherheit.
Unabhängig davon ist der Vormarsch von KI in der Medizin weltweit riesig – auch wegen dem Fehlerfaktor Mensch und dem Fachkräftemangel. Gerade lokale, tiefergehende KI vor Ort ist in der Lage, genauere und privatsphärengeschütztere Diagnosevorschläge auf Basis von Bildern oder Stimmdaten zu erstellen. Und die KI wird auch bisher menschlichen Ärzten zugeschriebene Eigenschaften gewinnen, z. B. die Empathie. Die Erkennung von Emotionen und Wohlbefinden ist in der KI längst Realität. Neben einer personalisierten und »menschlichen« Patientenbetreuung werden wir hoffentlich schon mittelfristig die Zulassung von individuellen Arzneimitteln gerade für seltene Erkrankungen erleben. (uh)





