Dr. Gourab Majumdar, Mitsubishi Electric
Power-Module »intelligent« machen
Fortsetzung des Artikels von Teil 2
Kommende Trends bei IGBT-Modulen
Welches sind die kommenden Trends für die nächsten Jahre in Bezug auf IPMs? Höhere Leistungsdichte beispielsweise?
Natürlich ist eine höhere Leistungsdichte ein immerwährender Trend, aber ich sehe auch eine steigende Integration weiterer Funktionen als weiteren wichtigen Zukunftstrend. Das IoT und im Rahmen von Industrie 4.0 vernetzte Antriebe erhöhen einerseits den Bedarf, Informationen und Daten aus den Komponenten wie einem IPM auszulesen, andererseits besteht aber auch die Forderung nach einer Steuerung des Gesamtsystems einschließlich Fernüberwachung und Fernbedienung. Wir haben es hier mit einer bidirektionalen Kommunikation zu tun. Und mit seiner Möglichkeit der Integration kann ein IPM diese Art von Anforderungen recht leicht erfüllen im Gegensatz zu einer diskreten Lösung.
Was sind die wichtigsten Parameter, die ein Entwickler beachten sollte, wenn er ein IPM für seine Anwendung auswählt?
Im Grunde läuft es ganz ähnlich wie bei der Auswahl für ein Standard-IGBT-Modul. Im ersten Schritt sieht man sich die Datenblattwerte für maximale Spannung und Strom an, die Notwendigkeit eines Deratings und damit einer Sicherheitsreserve in der eigenen Anwendung, Gehäusegröße sowie die Effizienzsteigerung, die sich her-ausholen lässt.
Danach muss der Anwender aus der Designperspektive heraus die Vorteile eines geeigneten IPMs gegenüber einer Lösung, die auf einem IGBT-Modul basiert, oder einer diskreten Lösung beurteilen. Er sollte auch auf spezielle Vorteile schauen, die er durch die Wahl eines IPMs erhalten kann. Ein Beispiel wären die integrierten Treiber- und Schutzfunktionen, welche die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Gesamtsystems verbessern können. Die neue Generation der G1-Module von Mitsubishi beispielsweise verfügt über erweiterte Funktionen wie codierte Fehlerausgabe, die bei der Diagnose und dem Abstellen von Störungen im Design helfen können. Diese neue IPM-Generation bietet auch eine Funktion zur Änderungen der Schaltgeschwindigkeit in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom, um Störabstrahlungen zu minimieren und EMV-Probleme zu vermeiden.
Jobangebote+ passend zum Thema
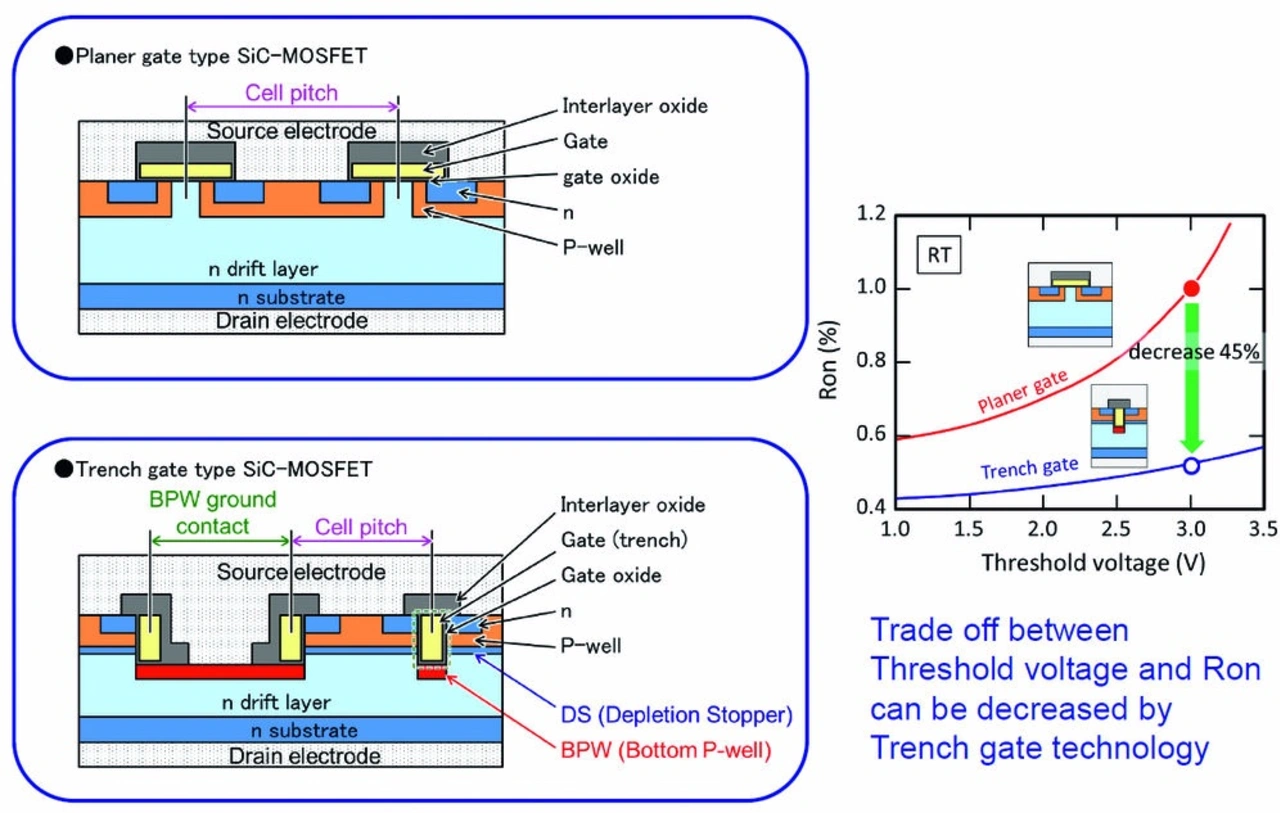
Welche Fallstricke sollten Anwender vermeiden?
Da IPMs über integrierte Schutzfunktionen verfügen, könnten sie nur aufgrund von Ursachen versagen, die nicht durch diese Schutzfunktionen abgedeckt sind. Spannungsüberschwinger im Ergebnis unangemessener Applikationsbedingungen sind eine solche Möglichkeit. Auch EMI oder Störsignale aus der Umgebung können zu einem unbeabsichtigten Schalten von IGBT-Chips in einem IPM führen. Deshalb sollten sich die Anwender ihr Design unter Worst-Case-Anwendungsbedingungen verifizieren sowie ihr Leiterplattenlayout und die Schnittstellenschaltung anschauen.
Manchmal versagen IPMs auch durch schnelle Temperaturänderungen bei sehr abrupten Änderungen der Betriebs- beziehungsweise Lastbedingungen sowie bei irgendwelchen abnormen Umgebungsbedingungen. Diese Fälle sind durch den integrierten Temperaturschutz nicht abgedeckt. Grundsätzlich sind solche Fälle aber dank dieser Schutzfunktionen sehr selten und liegen im niedrigen ppm- oder gar ppb-Bereich.
Herr Dr. Majumdar, vielen Dank für Ihre Zeit.
Das Interview führte Ralf Higgelke.
- Power-Module »intelligent« machen
- Was sich in sieben IGBT-Generationen getan hat
- Kommende Trends bei IGBT-Modulen