Digitale Biomarker
Wenn der Algorithmus die Diagnose stellt
Niereninsuffizienz oder Leberkrebs? Bei »stillen Leiden« mussten Patienten bisher vom Hausarzt, zum Facharzt, zur Spezialambulanz. Julian Müller von Roche Diagnostics erläutert, wie CE-zertifizierte Algorithmen eine schnelle, präzise Diagnose liefern – und die gesamte Versorgungskette verändern.
Dieser Beitrag erscheint am 27. Oktober 2025 in der Ausgabe 5 der Elektronik Medical. --> Hier können Sie das gesamte Heft als E-Paper lesen.
Roche Diagnostics hat 2023 den ersten »digitalen Biomarker« vorgestellt: Wie hat sich die Algorithm Suite entwickelt?
Vor zwei Jahren, mit nur einem Algorithmus, war die Idee eines Medical App Stores für CE-zertifizierte Algorithmen schwer zu erklären; es glich mit dem Gaad-Score für Leberkrebs eher einem Feldversuch. Nun füllt sich die Plattform: Zum einen mit selbstentwickelten Algorithmen unserer Roche-Reagenzien und zum anderen scouten wir CE-zertifizierte Algorithmen von Start-ups für unsere Plattform. Für die Kliniken und Labore hat dieses Vorgehen den Vorteil, dass sie nicht mit jedem Anbieter selbst in Vertragsverhandlungen und die Integration gehen müssen. Wir sind meist bereits eingebunden und der Kunde bekommt so aus einer Hand – quasi iPhone-artig – Zugriff auf eine große Bandbreite an medizinischen Algorithmen.
Welche Abrechnungsmodelle gibt es?
Die sogenannten »High-Medical-Value«-Algorithmen, die einem Durchbruch gleich völlig neue Sichtweisen in der Diagnose erlauben, rechnet Roche »Pay-per-Use« ab, also pro Berechnung. Auf der anderen Seite stehen die »Commodity«-Algorithmen – simple Berechnungen, die bereits heute in jedem Labor, in jeder Klinik per Hand durchgeführt werden und die von uns CE-zertifiziert wurden. Diese sind nun immer zu 100 Prozent korrekt und werden als Commodities im Abo-Modell angeboten.
Wie viele Algorithmen sind aktuell verfügbar und welche davon mit High-Medical-Value?
Wir liegen – Stand Q4 – bei zehn Algorithmen. Drei davon mit »High-Medical-Value«, einer ist unser erster mit KI trainierter Algorithmus »Klinrisk«, der Niereninsuffizienz prognostizieren kann. Dieser Machine-Learning-Algorithmus wurde mit riesigen Datensätzen trainiert und hat anhand einer Palette an Parametern herausgefunden, die Nieren welcher Patienten voraussichtlich in die Unterfunktion gehen werden. Das ist komplett neu. Niereninsuffizienz hat anfangs keine spezifischen Symptome und wird dadurch oft erst in Stadium drei oder vier diagnostiziert. Der neue Algorithmus kann dies bereits sehr früh, also wenn noch überhaupt keine Symptome vorliegen und der Patient noch keine Diagnose gestellt bekommen hat.1
D.h. Sie setzen auf zwei unterschiedliche Ansätze in der Algorithmenentwicklung?
Korrekt. Der erste Ansatz basiert auf der statistischen Analyse von großen Datenmengen, aus denen ein Algorithmus abgeleitet wird. Das Modell ist eine klare, offengelegte mathematische Formel, bei der genau nachvollziehbar ist, wie das Ergebnis berechnet wird. Dieser »White-Box«-Ansatz schafft Vertrauen und ermöglicht es Ärzten, die Logik hinter der Vorhersage zu verstehen. Mit dieser Transparenz und umfassenden Validierungen ist der Ansatz ideal für standardisierte Risikobewertungen.
Der zweite Ansatz basiert auf dem im Machine Learning üblichen »Random Survival Forest-Prinzip« (RSF): Die Maschine bekommt einen riesigen Datensatz und findet selbst die Lösung, ohne dass wir danach fragen. Der Algorithmus trifft basierend auf tausenden Entscheidungsbäumen eine präzise Vorhersage. RSF ist der menschlichen und statistischen Analyse meist überlegen, da es komplexe Interaktionen zwischen Variablen erkennt und auch mit fehlenden Daten – wie in Patientenakten – umgehen kann. Allerdings ist dieser »Black-Box«-Prozess für den Menschen nicht nachvollziehbar. Der Mangel an Transparenz ist das größte Hindernis für die klinische Akzeptanz. Ärzte tragen die Verantwortung für die Diagnose, können aber die Entscheidung der KI nicht komplett nachvollziehen. Zudem benötigen diese Modelle große, qualitativ hochwertige Datensätze, die in vielen Krankenhäusern noch nicht zentral verfügbar sind. Daher legen wir großen Wert darauf, diesen Ansatz stets im Rahmen von Studien klinisch zu validieren.
|
Stimmen, Bilder, Impressionen: Das war der »Health Electronics Summit« 2025 |
|---|
| Julian Müller zeigte auf unserem Entwicklerforum in Nürnberg anhand der CE-zertifizierten Navify-Algorithmen-Suite, was bereits heute in der Versorgungskette möglich ist, wenn Ärzte zur Diagnose nicht nur Blutwerte sondern Prognose-Scores als prädiktive Biomarker anfordern. |
Setzen Sie bereits auf selbstlernende KI in Ihrem Entwicklungsprozess?
Nein, das hängt unter anderem auch an der Regulatorik. Unsere CE-zertifizierten Produkte haben üblicherweise IVD-Klasse III, diese Algorithmen dürfen per Gesetz nicht ohne Neuzertifizierung dazulernen. Das macht das Ganze langsam und teuer.
In den USA können Hersteller mit dem Predetermined Change Control Plan (PCCP) künftige Änderungen bereits bei der Erstzulassung genehmigen lassen. Der Plan legt fest, welche Anpassungen der Algorithmus vornehmen darf und wie diese validiert werden müssen, ohne die Patientensicherheit zu gefährden. So kann sich der Algorithmus nach Inverkehrbringung kontinuierlich und sicher verbessern, ohne für jede Änderung eine neue Zulassung durchlaufen zu müssen. Die FDA will so die Patientensicherheit mit der Innovationsgeschwindigkeit der KI-Technologien in Einklang bringen.
Die EU dagegen setzt für MDR und IVDR auf einen reaktiven Ansatz. Macht ein Hersteller eine »signifikante Änderung« am Design oder der Zweckbestimmung eines Produkts, muss er in der Regel ein neues Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen. Dieser Ansatz ist weniger auf die kontinuierliche Weiterentwicklung von lernenden Algorithmen und deren iterative Verbesserung ausgelegt. Zudem hängen wir noch am Data Act, der selbstlernende künstliche Intelligenz in der Medizin als Hochrisiko-Anwendung einstuft.
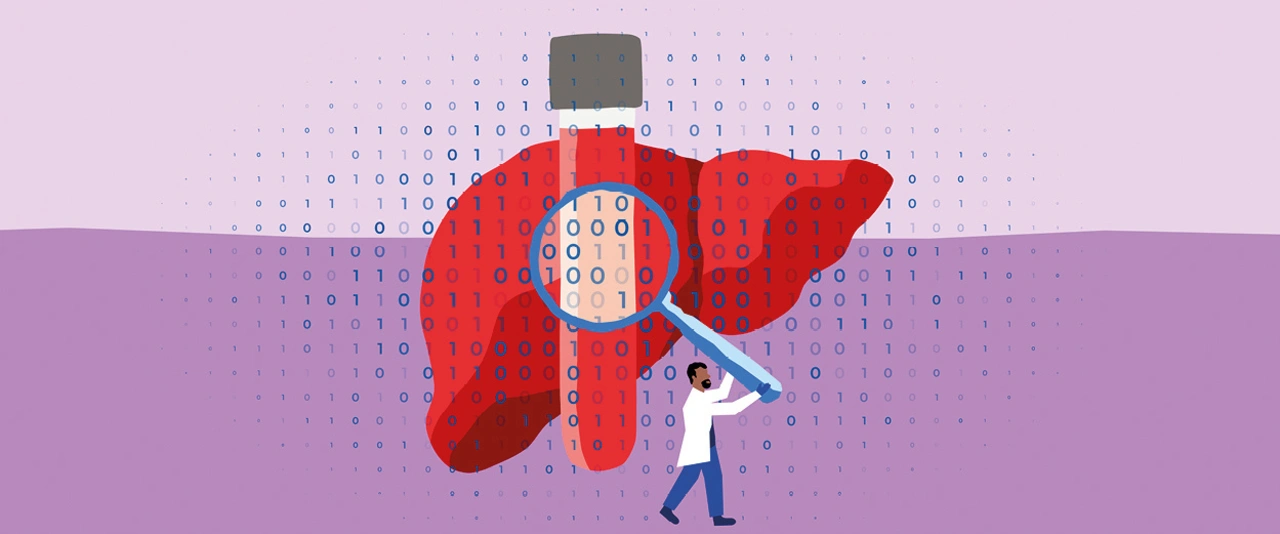
Wie arbeiten Ärzte und Labore in der Praxis mit den Algorithmen?
Perspektivisch wollen wir als Roche die Ärzte und Patienten mit digitaler Diagnostik, also einem Algorithmen-Paket, über den gesamten klassischen Patientenpfad unterstützen. Nehmen wir das Beispiel Leber: Mit dem Commodity-Algorithmus »FIB4« sprechen wir über ein ganz frühes Screening und im schlimmsten Fall begleiten wir den Patienten dann bis zur Transplantation. Der Meld-Score wird benötigt, um auf die Transplantationsliste in Deutschland zu kommen.
Als praktisches Beispiel eignet sich der Adapt-Score: Er schätzt das Risiko einer Fibrose ein und wird mit der Reagenzie Pro-C3 genutzt. Hier werden Alter, Diabetes-Status und Anzahl der Blutplättchen zusätzlich zum Reagenz herangezogen, um vorauszusagen, ob die Leber eines Patienten eine fortgeschrittene Fibrose aufweist.2
Wie kann der neue Score die Diagnose und Behandlung verändern?
20 bis 30 Prozent der Deutschen haben eine Fettleber, aus der sich mit der Zeit eine Fibrose entwickeln kann. Bisher gab es außer einer Ernährungsumstellung keine Behandlungsoptionen. Mit neuen Medikamenten (wie Abnehmspritzen, Anm.d.Red.) lässt sich das Stadium einer fibrotischen Leber erstmals verbessern. Der Adapt-Score ist ausschließlich in Verwendung mit der Pro-C3-Reagenzie als Medizinprodukt zugelassen – das heißt, wir brauchen den Algorithmus, um aus dem Blutwert eine medizinische Ableitung treffen zu können. Gepaart mit den neuen Therapien ergeben sich damit für Patienten und auch Ärzte komplett neue Möglichkeiten.
Wie verändert sich damit der Weg durchs Gesundheitssystem?
Die Diagnosekette heute: Der Hausarzt beobachtet die Leberwerte über einen längeren Zeitraum. Wenn klassische Leberwerte regelmäßig erhöht sind, wird eventuell ein weiterer Bluttest verordnet – mit der Aufforderung gesünder zu essen und Sport zu machen. Vielleicht bekommt der Patient auch eine Überweisung zum Gastroenterologen, aber das läuft heute alles nicht standardisiert. Beim Facharzt gibt es dann einen Ultraschall und wenn der auffällig ist, wird der Patient in eine Leberambulanz geschickt. Dort wird eine Elastografie gemacht, die zeigt, wie steif die Leber ist. Die gesamte Untersuchung dauert rund 20 Minuten und beansprucht eine medizinische Fachkraft. Aber allein auf den Termin warten Sie als Patient bis zu neun Monate. Es passiert also ganz schnell mal ein Jahr oder sogar länger gar nichts.
Der Adapt-Score – bestenfalls durchgeführt beim Hausarzt – könnte hier eine vorgelagerte Indikation geben: Fibrose oder nicht? Muss der zum Gastroenterologen oder gleich in die Leberambulanz? Und selbst wenn der Score erst beim Gastroenterologen gemacht wird: Der Algorithmus könnte die völlig überlasteten Leberambulanz vor Patienten bewahren, deren Leber keine Fibrose aufweist – und den kritischen Patienten den Weg zu einer Therapie deutlich schneller bereiten.
Mit welcher Genauigkeit ist der ADAPT-Score denn zertifiziert?
Dazu haben wir öffentlich zugängliche Ergebnisse aus klinischen Studien: Kombiniert mit der Pro-C3-Reagenzie kommt der Adapt-Score auf eine Spezifität von über 90 Prozent. Die digitale Kombi könnte also perspektivisch in vielen Fällen eine sehr zeit- und ressourcenintensive Untersuchung ersetzen. Wir bringen mit dem Adapt-Score für die Fettleber zum ersten Mal eine Hochdurchsatzdiagnostik über einen Bluttest auf den Markt. Denn bisher bleiben 60 Prozent aller Fettlebern unerkannt. Die Patienten verbleiben viel zu lange beim Hausarzt, während sich in dieser Zeit eventuell eine Zirrhose entwickelt, die nicht mehr heilbar ist. Hier setzt der Adapt-Pro-C3-Score an.2
Wo liegen aktuelle Limitationen für die Diagnose-Algorithmen?
Wir haben noch viel Arbeit vor uns, erstens was die Laborverfügbarkeit der digitalen Biomarker betrifft – also, dass die Algorithmen tatsächlich in allen Laborkatalogen gelistet sind. Und zweitens kennen viele Ärzte das Prinzip noch nicht. Gerade in frühen Versorgungsstadien fehlt das medizinische Wissen zu den Scores. Hier braucht es noch viel Aufklärung.
Das Schöne ist: Der Workflow prinzipiell ändert sich weder für Labore noch für Ärzte. Die navify Algorithm-Suite kann über FHIR / HL7 an jedes Laborinformationssystem angeschlossen werden, aller Ergebnisse sind in den üblichen Tools einsehbar. Für einen Arzt sehen die digitalen Biomarker genauso aus wie die Blutwerte, nur eine neue Zahl auf dem normalen Laborbefund.
Die größte Limitation der digitalen Biomarker jedoch ist die bisher fehlende Vergütung. Aktuell scheitert die Erstattung noch an Eintrittsbarrieren, die teilweise Jahrzehnte alt sind. Bestes Beispiel: Die Präambel zu Kapitel 32 EBM regelt, dass die rechnerische Ermittlung von Ergebnissen aus anderen Messwerten nicht abrechnungsfähig ist. Damit sollte damals verhindert werden, dass ein Arzt jede angewandte Formel abrechnen kann. Das hat nichts mit den heutigen Algorithmen und Scores zu tun, deren diagnostische Leistung in aufwendigen Studien belegt werden muss, um eine CE-Markierung zu bekommen.
Gibt es Fortschritte in der Erstattung?
Wir arbeiten intensiv daran. Die Radiologie und die Pathologie haben mit der digitalen Bildanalyse ja das gleiche Problem. Die Politik muss erkennen, welch Hemmnis dies für die Digitalisierung in Deutschland darstellt – Adaption kommt durch Erstattung. Der Einsatz der Algorithmen würde durch eine Vergütung den größten Push bekommen.
Natürlich gibt es auch heute schon Vordenker, die erkennen, wieviel Arbeitskraft eine MTA sich mit Bluttest und Score statt Ultraschall sparen kann. Allein die Workflow-Ersparnisse ergeben bereits ein positives Ergebnis und viele Ärzte wissen bereits um den Wert der digitalen Biomarker. Aber gegenüber einem ITler oder einem Geschäftsführer muss man das erstmal nachweisen, das muss einem jemand glauben, das ist nicht so sexy wie eine Vergütung.
Wie werden die digitalen Biomarker die Versorgung langfristig beeinflussen?
Digitale Biomarker werden unsere Medizin nachhaltig erweitern. Ich denke, es wird für sämtliche Krankheiten digitale Unterstützung geben. Wir sehen heute bereits Algorithmen für die Herzinfarkterkennung in der Notaufnahme, einen Sepsis-Algorithmus auf Station konnten wir in den USA bereits von der FDA zertifizieren lassen. Das wird für sämtliche Indikationen kommen und der Umfang und das Potenzial der digitalen Biomarker lässt sich nicht mehr bestreiten.
Gerade in der Prävention, wo in Deutschland meines Erachtens noch viel Potenzial liegen gelassen wird, können Algorithmen viel bewegen. Insbesondere in der Früherkennung lassen sich über die digitalen Biomarker große Patientenströme früher zu guten Medikamenten leiten – und ersparen dem Gesundheitssystem später extrem teure Therapien. Wenn wir beim Beispiel der Leberambulanzen bleiben: Die bekommen mit einem Risiko-Score auch ein gutes Mittel zur Priorisierung an die Hand. Gleichzeitig merken Patienten, die bisher durch die langen Wege zwischen den Ärzten eingeschüchtert sind und denken »wird schon nicht so schlimm sein«, wie ernst ihre Krankheit in Wirklichkeit ist. Dazu ist es auch eine Motivation, etwas am eigenen Verhalten zu ändern, da der Patient sehr oft einen eigenen Beitrag zu einer Verbesserung seines Krankheitsbilds leisten kann.
Wie werden digitale Biomarker die Therapien beeinflussen?
In der personalisierten Medizin werden wir an den Punkt kommen, an dem bestimmte Medikamente nur nach einem vorherigen Score verschrieben werden. Nicht, um jemanden auszuschließen, sondern weil wir aufgrund von Datenanalysen wissen, dass gewisse Gegebenheiten vorliegen müssen, damit eine Therapie funktioniert. Digitale Biomarker integrieren KI-basiert viele unterschiedliche Daten und können den Erfolg eines Medikaments besser voraussagen. Klinische Studien zeigen vielversprechende erste Ergebnisse auf dem Weg in diese personalisierte Therapie. (uh)
1 Kidney Klinrisk Algorithm · Software version 1.0 · User Guide · Publication version 1.0
2 Roche, Elecsys PRO-C3 Method Sheet Mat-Nr: 09088423190, v1.0, 2025


