Digitalisierung gegen Industrie-Sterben
»Wo bin ich digital, wo muss ich es sein?«
Fortsetzung des Artikels von Teil 1
Mit Edge-Architektur zum digitalen Zwilling
Für Phillip Guth braucht erfolgreiche Digitalisierung ein Gesamt-Konzept und zunächst schmerzhafte Basisarbeit: »Datenbereinigung, Schnittstellen-Abstimmung sowie die Interpretation strukturierter Daten als Basis jeglicher Information und Entscheidung benötigen ein hohes Invest, ohne direkten Return.« Diesen Schritt zu überspringen bringe aber rein gar nichts.
Auch für den IT-Mensch Ritz kommt es darauf an, die Gesamt-IT-Architektur betrachten, »weg von einzelnen Tools oder Insellösungen«. Fertiger sollten frühzeitig mit den Anlagenbauern sprechen und gemeinsam Datenformate definieren. »Eine neue Maschine zu integrieren sollte so einfach sein wie einen Drucker installieren.« Um die Edge wird aufgrund der IT-Komplexität bald keine Produktionsfirma mehr herumkommen. Digitale Zwillinge müssten die ganze Linie übergreifend betrachten können, daher muss »die Edge von Anfang an in die Architektur eingebaut sein«.

Digitale Test-Fabriken und Proofs of Concept
»Das geht auch ohne große IT-Berater,« sagt Ritz. Sein Tipp ist der Besuch deutscher Test-Fabriken. Die beteiligten Forschungseinrichtungen sind gern bereit, »Use Cases und Probleme zu diskutieren«. So sieht das auch Katharina Eylers und empfiehlt, mit einem konkreten Ziel den »Haus-und-Hof-Systemintegrator« anzusprechen und im Loslegen »die Angst vor dem riesigen Apparat Industrie 4.0 zu verlieren«.
»Ein eigenes, kleines Team aus der Produktion kann mit Werker-Verständnis neue Projekte antreiben und Ideen pitchen,« sagt Dr. Ritz und empfiehlt, Digitalprojekte über kleine Testballons zu starten. Zum Erfahrungen Sammeln ließen sich Proofs of Concept auch mit Partnern wie Fraunhofer, den IHKs oder den Smart Factories starten.
Desweiteren empfiehlt der GEC-CEO einen Blick auf das europäische Förderprojekt Gaia-X, um Uses Cases zu prüfen sowie neue Geschäftsmodelle anzudenken. »Die dortigen Fördergelder können gerade dem Mittelstand einen ordentlichen Boost geben«, sagt Dagmar Dirzus. Auch Katharina Eylers sieht in der europäischen Dateninfrastruktur einen wichtigen Ansatzpunkt, Fragen zu Datenaustausch und Datensicherheit anzugehen und zu klären – insbesondere bezüglich des Daten- und Informationsaustauschs mit nicht deutschen Partnern. »Das Potenzial ist groß«, sagt Eylers und schränkt gleichzeitig ein: »wenn es sich zum Mittelstand durchgesprochen hat, was Gaia-X ist, was es bedeutet und wie ein Unternehmen es für seine Zwecke nutzen kann«.
Nicht nach China schauen, in China sein
Für Dagmar Dirzus lohnt der Blick nach China. »Die Geschwindigkeit und Dynamik ist dort eine völlig andere. Die kopieren nicht mehr, die innovieren.« Dirzus bringt ein Beispiel aus der Sensortechnik. »Eine deutsche Firma baut ein extrem präzises Messinstrument, DIN-zertifiziert, sehr teuer.« Der chinesische Ansatz wäre, günstigere, weniger exakte Sensoren einzusetzen und deren Schwarmintelligenz per KI zu nutzen. »Dann habe ich den richtigen Messwert – billiger, flexibler, sogar zum Nachjustieren und mit stetigen Updates. Die Sensorfusion schafft den Mehrwert. Diese digitalen Plattformen müssen wir selbst bauen, mit besseren Sensoren.« Um wirklich zu verstehen, wie der Markt läuft, müsse auch der Mittelstand in China vertreten sein. »Nicht nur nach China schauen, in China sein!«, mit einer eigenen Niederlassung oder zumindest über Partnerschaften.
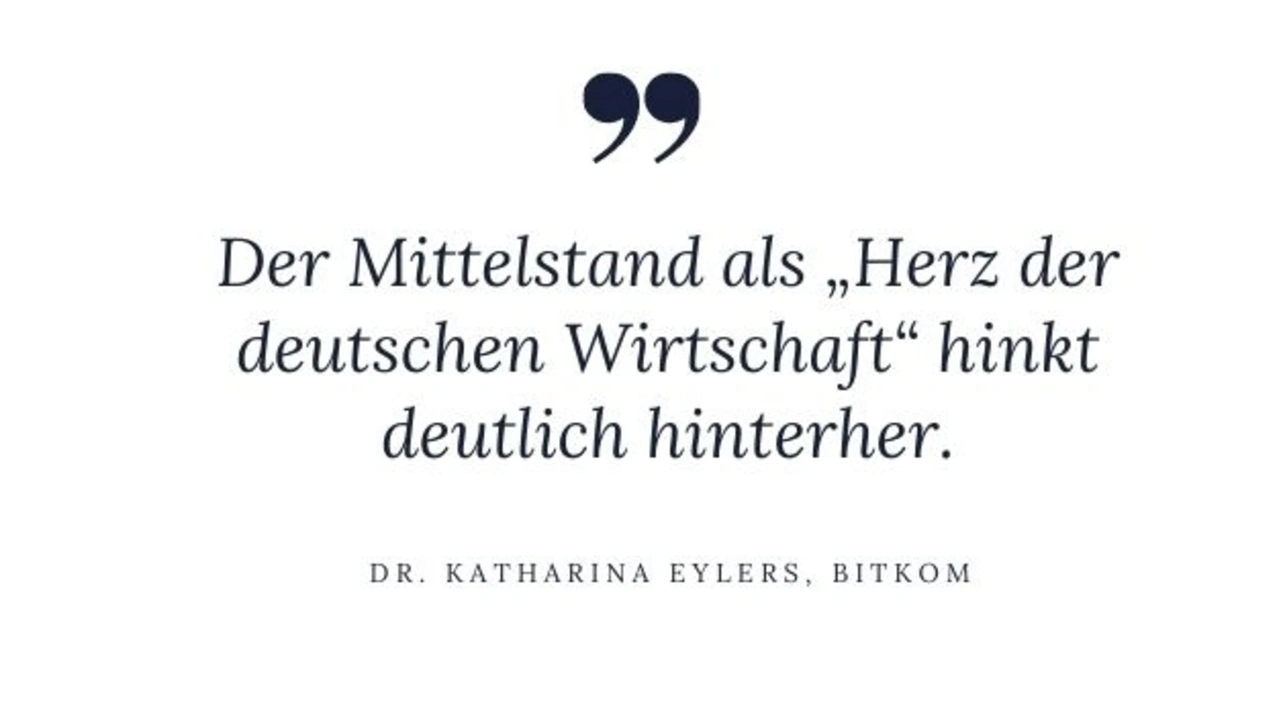
Neue Personalpolitik
»In vielen Firmen ist nicht genügend Personal mit den richtigen Skills und dem Wissen um Digitalisierung vorhanden«, sagt Katharina Eylers. Dr. Dagmar Dirzus bestätigt, dass es an Know-how und vor allem Programmierkräften fehle, die bei den internationale Tech-Stars mit hohen Einkommen gelockt würden. Viele Unternehmen seien zwar bereit, zusätzliches Personal einzustellen, so Eylers, doch für Mittelständler in der Provinz sei es schwierig, gut ausgebildete Hochschulabsolventen aufs Land zu bekommen. »Freelancer oder Leute, die dann aus Berlin arbeiten, da müssen Firmen offen für neue Arbeitsmodelle sein.« Für Dirzus reicht das nicht: »Firmen müssen offen und flexibel genug sein, Menschen weltweit einzustellen, die dann auf ihren Projekten arbeiten.«
»Der Kulturwandel ist eine Herausforderung«, sagt Phillip Guth. Bosch Rexroth will auch langjährige Mitarbeiter mitnehmen. »Natürlich stößt ein Software-Geschäftsmodell zunächst auf Skepsis, wenn eine Firma jahrelang erfolgreich mit Geräten war. Bloßes Erzählen reicht dann nicht, die Leute müssen es erleben.« Der Fertiger setzt auf Pilotprojekte und Vorbilder. »Dynamische Menschen gibt es in jeder Firma, die helfen ungemein, auch langgediente Mitarbeiter auf neue Wege mitzunehmen – deren Erfahrung wird dringend gebraucht.«
- »Wo bin ich digital, wo muss ich es sein?«
- Mit Edge-Architektur zum digitalen Zwilling