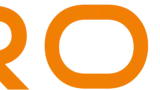Forum Künstliche Intelligenz der M&T
Künstliche Intelligenz ist reif für die Industrie
Künstliche Intelligenz ist reif für industrielle Anwendungen: In der Bildverarbeitung gehört sie bereits zur Normalität, doch ansonsten beginnt sie erst jetzt, sich zu etablieren. Wie weit ist sie damit fortgeschritten, welche Hemmnisse gibt es noch, und welche Hardware ist für welche KI nötig?
Im Forum Künstliche Intelligenz der Markt&Technik nahmen neun Expertinnen und Experten aus der Industrie Stellung.
KI dringt allmählich in die industrielle Produktion vor – und am weitesten gekommen ist sie dabei in der industriellen Bildverarbeitung. Für viele Bildverarbeitungs-Anwendungen gibt es mittlerweile KI-Alternativen zu den klassischen Verfahren, sei es in der optischen Zeichenerkennung (OCR) oder wenn es darum geht, variierende Formen zu erkennen und Anomalien zu detektieren. Entscheidend für Nutzer von Bildverarbeitungstechnik ist daher vor allem, herauszufinden, welche Methode – ob KI-basiert oder klassisch – je nach Anwendung ihren Zweck besser und in einem günstigeren Kosten-Nutzen-Verhältnis erfüllt.
In der Bildverarbeitung ist KI am weitesten fortgeschritten
IDS Imaging Development Systems bietet schon seit fast fünf Jahren intelligente Kameras an, die eigens für die Bildverarbeitung auf Basis von KI entwickelt sind. Bei ihnen handelt es sich um Inferenzkameras, die zuvor trainierte neuronale Netze nutzen, um ihr durch Deep Learning erworbenes »Wissen« auf neue Daten anzuwenden. Dadurch werden Aufgaben automatisch lösbar, die mit regelbasierter Bildverarbeitung gar nicht oder nur mit großem Aufwand zu realisieren wären. Laut IDS zeichnet sich das KI-Bildverarbeitungssystem des Unternehmens dadurch aus, dass von der Kamera-Hardware einschließlich selbst entwickeltem KI-Core über die intuitiv bedienbare Trainings-Software zur Erstellung individueller künstlicher neuronaler Netze bis zum Support alles aus einer Hand stammt.
Reif für die Industrie



Forum Künstliche Intelligenz der Markt&Technik
Komplette Systeme für die Bildverarbeitung auf KI-Basis sind also erhältlich, und die nötige Akzeptanz am Markt ist inzwischen vorhanden. »Die Akzeptanz von KI war aber auch in der Bildverarbeitung kein Selbstläufer«, betonte Patrick Schick, Product Owner 3D & Vision Software bei IDS. »In den letzten Jahren haben wir das Thema diskutiert: Was kann KI eigentlich? Inzwischen, etwa seit einem Jahr, ist das entscheidende Thema aber offensichtlich: Wie lang sind die Inferenzzeiten in den Systemen? Das zeigt, dass wir auf einem neuen Level angekommen sind, dass jetzt nicht mehr so sehr darüber diskutiert wird: Wo setzen wir es ein, sondern eher: So können wir es einsetzen.« Es gehe also mehr um das Wie als um das Ob – sprich: die Akzeptanz sei jetzt gegeben und steige weiter.
Einen wachsenden Zuspruch findet KI in der Bildverarbeitung auch aus der Sicht von MVTec Software. Als Hersteller von Standard-Software für die Bildverarbeitung bietet das Unternehmen einen Werkzeugkasten verschiedener Technologien an, von Identifikation über 3D bis KI, den die Anwender nutzen, um spezifische Lösungen umzusetzen. »Es gibt ein Riesen-Interesse an KI, und spätestens seit ChatGPT, mit dem viele experimentieren, hat sich das Interesse nochmal verstärkt«, sagte Dr. Maximilian Lückenhaus, Director Marketing + Business Development bei MVTec Software. »Zudem gibt es einen großen Druck in den Unternehmen, sich mit KI zu beschäftigen, ein bisschen auch aus Selbstzweck. Es zeigt sich aber auch eine große Ernüchterung bei vielen.« Lückenhaus zufolge glauben nur noch wenige, dass KI ein Allheilmittel ist, aber viele sehen, dass es eine wichtige Technologie ist, mit der sie sich beschäftigen müssen. Und deshalb haben sich seines Erachtens die Fragen der Kunden so verändert, dass sie sich um konkrete Anwendungen drehen: »Die Kunden sagen beispielsweise, ich habe hier eine Klassifikation, aber bekomme sie in meine Maschinensteuerung nicht hinein, weil solche Kombinationen aus verschiedenen Technologien bei vielen Open-Source-Produkten und einfachen KI-Lösungen gar nicht angedacht sind«, führte er aus. »Wir haben auch einige Kunden, die KI tatsächlich schon einsetzen; die meisten nutzen sie in Kombination mit klassischen Bildverarbeitungstechniken, indem sie KI beispielsweise verwenden für eine Vorklassifikation, um sagen zu können: da ist tatsächlich eine Region of Interest, innerhalb derer ich dann hochgenau mit klassischen Methoden vermessen kann. Das machen relativ viele Unternehmen.«
Zurückhaltung sieht Lückenhaus bei Anwendungen, für die Zertifizierungen nötig sind, sowie bei Anwendungen, in denen das Thema Datensicherheit eine Rolle spielt. »Wo liegen die Daten – in Europa, in den USA oder in China? Wer hat überhaupt Zugriff auf die Daten? Für unsere Kunden sind das wichtige Fragen in einem Moment, in dem das Thema KI für die Industrie spannend und greifbar wird.«
Außerhalb der Bildverarbeitung generell noch Zurückhaltung
Beim Blick in Anwendungen außerhalb der Bildverarbeitung zeigt sich jedoch, dass die Akzeptanz der KI in der Industrie noch zu wünschen übriglässt und erst jetzt Fahrt aufnimmt. Tanja Maaß setzt sich als Geschäftsführerin zunächst von Resolto Informatik und jetzt von Nexoy seit 2003 mit lernenden Algorithmen auseinander, von Anfang an mit Blick auf die Industrie: »Das mit der Akzeptanz war schon ein zäher Prozess; ich hatte gedacht, dass es viel schneller geht, zumal KI ja auch wirklich coole Möglichkeiten eröffnet«, sagt sie. »Bei naheliegenden Automatisierungs-Anwendungen wie Predictive Maintenance und Qualitätssicherung oder auch im Health-Scoring sind wir seit zehn Jahren in den Startlöchern. Ich denke aber, dass es jetzt losgeht, dass die Akzeptanz wirklich kommt. Wir sehen, dass die Pilotprojekte erfolgreich sind und tatsächlich auch in Rollouts überführt werden. Und wir haben gesehen, dass große Konzerne, vor allem im Automotive-Bereich, und auch andere Anwender in das Thema einsteigen, zwar unter Voraussetzungen, aber immerhin. Da tut sich was.«
Martin Steger beschäftigt sich als Geschäftsführer von iesy seit mehr als 20 Jahren mit modularen und skalierbaren Embedded-Computer-Systemen und bemerkt in puncto KI-Nutzung eine gewisse Ernüchterung: »Bisher sehen wir kaum praktische Anwendungen von KI. Klar ist aber, dass die Branchen, die von KI profitieren könnten, diese Vorteile jetzt besser verstehen und artikulieren. Sie spezifizieren ihre Anwendungen und passen ihre Systeme entsprechend an. Dadurch können wir die Hardware so konzipieren, dass unsere Kunden in ein oder zwei Jahren KI-Anwendungen nutzen können, ohne dass diese jetzt schon existieren.« Generell gebe es den einen Startschuss nicht: »Es sind viele Schritte, die jetzt eingeleitet werden. Grundsätzlich ist jedoch eine Öffnung des Embedded-Marktes zu beobachten. Neben den etablierten x86- und Arm-CPU-Cores gewinnen CUDA- und Tensor-Cores zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung wird die kommenden Jahre maßgeblich prägen.«
Ein entscheidendes Kriterium für die Nutzung von KI in der Industrie ist wirtschaftlicher Art: Es muss sich rechnen. Denn letztlich müssen alle Unternehmen mit dem, was sie tun, nun mal Geld verdienen. »In den letzten drei Jahren durften wir verschiedene Hardware für Kunden entwickeln mit einer gewissen KI-Fähigkeit, aber die letzten eineinhalb Jahre haben viel Bewegung gebracht, das Wissen und das Bewusstsein für die Projekte nimmt zu – und auch die Klarheit, wie ein Business-Case aussehen soll, damit er sich trägt«, sagte Oliver Roth, CEO der Amalthea Group und der dazugehörigen Grossenbacher Systeme AG, die Embedded-Systeme – Controller (gegebenenfalls mit KI), Displays, aber auch IoT-Devices im weitesten Sinne mit unterschiedlichen Funktechnologien – entwickelt und fertigt. »Wir sehen uns hier als Partner, der die Kunden auf diesem Wege begleiten will – mit klarem Blick, welche Projekte auch wirtschaftlich eine Chance haben. Denn Embedded KI erfordert die entsprechende Hardware. Stückkosten und Pflegekosten für die Algorithmen sind einzukalkulieren. Es ist deshalb auf jeden Fall wichtig, intensiv über den Business-Case nachzudenken: Welchen Nutzen soll die KI bringen, denn sie wird kosten. Sie kostet, wenn sie embedded ist, KI kostet aber auch, wenn ich Calls in ChatGPT auslöse. Und wenn ich sie im Produkt realisiere, erhöht dies je nach Anwendungsfall die Hardware-Kosten. Dem Produktmanager stellt sich natürlich die Frage, ob das entstehende Produkt vom Preis her noch tragfähig ist: Erhöhter Preis muss in Relation zum Mehrwert durch KI stehen.«
Oliver Roths Unternehmensgruppe ist nicht im Bildverarbeitungsbereich tätig: »Davon haben wir bewusst Abstand genommen, wir konzentrieren uns auf andere Anwendungsfälle der KI.« Er bestätigt, dass KI in der Bildverarbeitung wohl schon am weitesten sei, aber andere Bereiche kämen jetzt auf das Unternehmen zu: »Bei vielen KMU kommt jetzt das Bewusstsein für die Möglichkeiten mit KI auf, es kommt jetzt richtig in Schwung. Der Maschinenbau, aber auch andere Branchen und Wirtschaftsbereiche mit industriellen Anforderungen liegt uns besonders am Herzen. Wir meinen, dass wir sowohl clevere Hardware-Lösungen mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis als auch die richtige Projektmethodik aufzeigen können.«
Ein Missverhältnis zwischen den Möglichkeiten, die KI in der Industrie inzwischen bietet, und der konkreten Implementierung von KI-Lösungen sieht auch Peter Müller, VP Productline Modules bei Kontron. Sein Unternehmen betrachtet sich als einer der Marktführer bei IPCs, HMIs und Computer-Boards, ist aber inzwischen stark mit dem Fokus unterwegs, komplette IoT-Applikationen zu unterstützen, sei es auf der Hardware-Seite, sei es im Kontext zusätzlicher Software oder auch OS-Lösungen, um den Anforderungen nachkommen zu können, die KI- oder Security-Themen mit sich bringen. »Es ist viel passiert von der technologischen Seite, also was man mit KI schon umsetzen kann, seitens der Hardware, aber auch der Software«, führte er aus. »In den letzten eineinhalb bis zwei Jahren ist viel an neuen Lösungen entstanden – und diese Lösungen sind auch präsenter bei den Kunden. Wir sehen aber noch nicht so viele Kunden, die das wirklich schon umgesetzt haben und wirklich aktiv bei der Implementierung im Prozess sind.« Auch er erkennt den Fortschritt daran, dass sich die Themen in Gesprächen mit den Kunden geändert haben: »Das Thema ist nicht mehr so sehr wie noch vor zwei Jahren: ‚Wofür kann ich KI eigentlich verwenden?‘, sondern eher: ‚Ich bin mir noch unsicher, welche Auswirkungen die KI-Lösung haben wird in meiner Applikation‘. Das heißt, viele Anwender haben noch Bedenken in puncto Cybersecurity oder fragen sich: ‚Was passiert mit meinen Daten, wie sind die Daten zu kontrollieren?‘ Das ist bei vielen noch ein Aspekt, warum sie zurückhaltend sind – und nicht so sehr, dass sie nicht wüssten, was man konkret mit KI anfangen könnte oder wo die Vorteile liegen in Sachen Predictive Maintenance oder auch Qualitätssicherung.« Vielen fehle einfach noch das Wissen oder der Background, wie sie sicher mit den Daten umgehen können.
Auch Christian Eder, Director Market Intelligence des Embedded- und Edge-Computing-Modul-Herstellers Congatec, betrachtet die technischen Voraussetzungen für einen breiten Einsatz von KI in der Industrie als gegeben, sieht aber momentan das »Tal der Tränen« im Sinne des Gartner-Hypecycles kommen: »Jeder will und macht, und großes Interesse ist da, aber man muss sich immer auch überlegen: Brauche ich einen KI-basierten Ansatz wirklich oder komme ich vielleicht mit einem klassischen Ansatz weiter? Oftmals ist klassisch sicherer und einfacher, als wenn ich ein KI-Thema daraus mache. Außerdem bedeutet KI immer eine wahrscheinlichkeitsbasierte Entscheidung, was gerade in konservativen Bereichen wie der industriellen Automatisierung, in der alles immer seine Richtigkeit haben muss, Schwierigkeiten aufwirft – man denke nur an das Thema Safety.« Aber es gebe natürlich viele Anwendungsbereiche wie Vision oder auch Medizin, in denen eine große Menge an sinnvoll nutzbaren Daten vorhanden sei – eine Voraussetzung dafür, überhaupt Anwendungen auf KI-Basis aufbauen zu können. »Ich denke, viele überlegen sich derzeit: ‚Was will ich eigentlich, was will ich machen, und welche Daten brauche ich dazu?‘ Und die Konsequenz daraus ist, die Daten in der entsprechenden Qualität zu sammeln, um überhaupt eine Chance zu haben.«
Parallel dazu wächst auch die Leistungsfähigkeit der Hardware: »Die neuen Chips der bedeutenden Hersteller bringen gewisse Merkmale wie etwa KI-Beschleuniger und Unterstützung bestimmter Software-Ecosystems mit. Da ist großes Engagement zu sehen, da kommt sehr viel. Generell kosten die nächsten Chip-Generationen jeweils das Gleiche wie die vorherigen und können mehr. Was jetzt passiert, ist, dass die nächsten Generationen jeweils schon mal einen KI-Beschleuniger mit drauf haben und trotzdem nicht dramatisch teurer sind.« Die technischen Hürden seien also genommen, die Rechenleistung sei da, aber: »Die Umsetzung wird noch spannend, da werden wir sicherlich zwei, vielleicht drei spannende Jahre haben, bis wir durch das Tal durch sind, aber dann geht es richtig los.«
Das Delta zwischen den vielen Möglichkeiten, welche die KI eröffnet, und der konkreten Umsetzung in der Industrie bewegt auch Stefanie Kölbl, Director of Business Unit TQ-Embedded bei der TQ-Group. Der Geschäftsbereich hat unterschiedliche Embedded-Module auf x86- und Arm-Basis in seinem Portfolio und entwickelt und fertigt die Produkte komplett inhouse. »Insofern machen wir uns auch intensiv darüber Gedanken, wo wir KI für die eigene Fertigung anwenden können«, sagte sie. »Wir haben uns relativ früh damit befasst; KI gab uns die Möglichkeit, unsere Fertigung zu optimieren und einige Schritte mittels Machine-Learning kontinuierlich zu verbessern. Die Weiterentwicklung von KI zu Machine-Learning, zu Deep Learning, jetzt zu generativer KI mit ChatGPT, da hat sich wirklich viel getan. Und man merkt inzwischen bei den Kunden: Es ist der Wille da, etwas umzusetzen, man will KI-ready sein, man will von der Hardware-Seite her alles abgedeckt haben.« Andererseits sei es bisher »noch nicht so, dass wir sagen könnten, wir hätten eine Vielzahl laufender Projekte bei unseren Kunden.«
Stark im Fokus stehen aus Stefanie Kölbls Sicht gerade die Themen Datensammlung sowie Edge und Cloud. »Für viele ist das Thema ‚Gehen wir in die Cloud, machen wir Edge-Computing?‘, das KI letztlich mit sich bringt, auch von der Embedded-Seite her interessant, worauf wir versuchen, von der Hardware-Seite her entsprechend zu reagieren.« Ihr Unternehmen habe aber auch die Software-Seite stark ausgebaut: »Wir haben inzwischen um die 100 Software-Entwickler inhouse und versuchen, unsere Kunden immer stärker auch von dieser Seite her zu unterstützen, um die Integration in ihre Produkte zu vereinfachen und ihnen einen sanften Einstieg in das Thema KI zu ermöglichen.« Ein interessanter Aspekt ist Stefanie Kölbl zufolge, dass die Kunden zunehmend fordern, Module »auf Zuwachs« zu entwickeln, damit sie zu gegebener Zeit für KI-Anwendungen einsetzbar sind: »Von der Chip-Seite her wollen immer mehr Kunden GPU und NPU in den Embedded-Modulen mit integriert haben, um in den nächsten Jahren die damit ausgestatteten Produkte weiterentwickeln zu können. Wir merken bei vielen neuen Produkten, dass sich die Kunden rüsten, dass es in die richtige Richtung geht, aber ich glaube auch, dass es noch das eine oder andere Jahr dauert, bis wir so weit sind, dass KI ein Selbstläufer wird und der Mehrwert wirklich in der Masse umgesetzt wird.«
Aus der Software-Perspektive zeigen sich extreme Ungleichheiten, was die Adaption von KI anbetrifft. »Viele unserer Kunden sind größtenteils noch mit klassischen Methoden unterwegs, also mit mathematischer Modellierung, Model-Based Design, sprich: mit klassischen Ingenieurdisziplinen, um ihre Systeme zu beschreiben und in die Anwendung zu bringen; seit der letzten Dekade nutzen sie aber zunehmend datenbasierte Modelle«, erläuterte Dr. Sarah Drewes, Senior Team Lead Consulting bei MathWorks. Ihr Unternehmen ist für Software-Produkte bekannt, unter anderem mit den Schwerpunkten KI und Embedded Systems, und ihr Team berät Kunden auch, wenn sie erstmals KI-Anwendungen ausprobieren wollen. »Generell sehen wir bei den Kunden in der Automatisierung und in der Elektronik eine extreme Bandbreite«, sagte sie. »Es gibt Kunden, die KI im Einsatz haben und alles komplett durchdacht haben mit automatischem Update von Modellen und anderem. Wir haben aber auch Kunden, die zu uns kommen und uns fragen: ‚Was mache ich denn jetzt mit KI?‘.« Seit etwa eineinhalb Jahren – sprich: seit Generative AI auf der Bildfläche erschienen ist – habe das Thema extrem an Bedeutung gewonnen: »Das Interesse ist nochmal gestiegen, und ich hoffe, dass sich noch mehr Möglichkeiten ergeben. Denn wir machen Projekte mit den Kunden und sehen, dass es viele Aspekte gibt, in denen wirklich viel Potenzial liegt, um Business-Probleme anzugehen. Bisher ist das eher in den klassischen Bereichen der Fall, die nichts wirklich Neues sind, also Predictive Analytics, Predictive Maintenance und Condition-Monitoring. Das waren unsere ersten Projekte, und beim Thema Vision-Inspection-Qualitätssicherung haben wir die meisten Erfolgsmodelle.«
Die Wahl des richtigen Boards
Industrieunternehmen, die KI-Anwendungen betreiben wollen, brauchen dafür natürlich eine geeignete Hardware. Die erste Frage ist hier, ob es sich um Ausführungs-Hardware oder um Trainings-Hardware handeln soll. »Wenn ich Trainings-Hardware brauche, bewege ich mich auf einem ganz anderen Level als bei Ausführungs-Hardware, was Leistungsfähigkeit und damit Kosten anbelangt«, legte Patrick Schick dar. Christian Eder konkretisierte: »Nvidia macht die großen Plattformen für Trainings, und wir machen die Ausführungs-Hardware, also die Module im Embedded-Bereich.«
Die Leistungsfähigkeit der Prozessor-Boards verhält sich also proportional zu der der KI, die darauf laufen soll. »Bei CPU-Boards gibt es High-Performance-CPUs und für kleine Rechenleistungen Low-End-CPUs«, führte Peter Müller aus. »Entsprechend brauche ich, wenn ich ein Ventil mit KI optimiert überwachen will, nur die Low-End-KI, und wenn ich eine High-End-Bildauswertung fahren will, die eventuell mit nicht vortrainierten Szenarien zurechtkommen muss, dann brauche ich das High-End-Niveau. Dass es hier eine Skalierung gibt, muss am Markt noch präsenter werden. Dann wird es auch klarer, wie das Kosten-Nutzen-Verhältnis für bestimmte Anwendungen aussieht. Wenn ich nicht mit einer vortrainierten Lösung arbeiten kann und dann vielleicht eine High-End-Nvidia-Karte benötige, habe ich ein ganz anderes Kostenniveau als bei den 80 oder 90 Prozent KI-Anwendungen, die ich mit einem einfachen CPU-Modul mit KI-Koprozessor bewältigen kann.« Dies werde aktuell nicht ausreichend differenziert am Markt.
Christian Eder hob jedoch hervor, dass es hier keine klaren Benchmarks gibt: »Eigentlich muss man die Hardware durchprobieren, um festzustellen, was für den entsprechenden Use-Case am besten ist. So verstehe ich das momentan vom Markt her.« Stefanie Kölbl ergänzte: »Was den Software-Einstieg angeht, würde ich zunächst einmal die günstigeren Varianten austesten. Wenn das Modul mit Haupt-Execution-Unit nur 10 Euro mehr kostet als ohne, dann wird es eher genutzt.«
Falls die Performance eines Boards für zukünftige Anwendungen nicht mehr ausreicht, gibt es immer noch eine Möglichkeit: »Computermodule allgemein lassen sich relativ leicht austauschen, das heißt, wenn ich merke, dass es nicht oder nicht mehr passt, dann kann ich auch skalieren«, sagte Christian Eder. »Das ist schon ein großer Vorteil.« Wobei bisher jeder ein anderes Software-Ecosystem habe: »Aber auch da tut sich etwas, auch da gibt es eine Vereinheitlichung.«
Aus Software-Sicht erscheint es sinnvoller, »nicht die Hardware durchzuprobieren, sondern den Modellansatz«, wie Dr. Sarah Drewes betont. »Wenn ich ein Modell habe, das in der Hardware laufen muss, dann berücksichtige ich das, sobald ich anfange, an meinem Projekt zu arbeiten. Das heißt, ich muss ein Modell finden, welches das Problem löst, und zwar mit den Ressourcen, die ich zur Verfügung habe – und siehe da: es geht. Die gegebenen Möglichkeiten sind ja praktisch unendlich.«