IoT – Cloud – Connectivity
Der neue Bosch IT-Campus von innen
Fortsetzung des Artikels von Teil 1
Keine feste Sitzordnung
Dazu hat Bosch im neuen Gebäude viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit geschaffen, aber auch Rückzugsräume, in die sich die Mitarbeiter zurückziehen können, wenn sie konzentriert arbeiten müssen. Was es allerdings nicht gibt: feste Arbeitsplätze oder Sitzordnungen. Stattdessen haben die Mitarbeiter Schließfächer und suchen sich einen für die jeweilige Tätigkeit passenden Arbeitsplatz. Für Besprechungen gibt es Sofa-Ecken, Lounge-artige Bereiche mit Tischen und Besprechungsräume, die allerdings nicht fest gebucht werden können sondern immer spontan belegt werden. Wer länger oder »engagierter« telefonieren muss, kann in eine gläserne Telefonzelle gehen, damit nicht das ganze Stockwerk Zeuge der Kommunikation wird.
Die Arbeitsmittel erhalten die Mitarbeiter in einem IT-Space, dessen »Showroom« Ähnlichkeiten mit den Flagship-Stores großer Marken aufweist – nur dass es hier die internen Geräte und die Beratung dazu gibt. Die Mitarbeiter können hier z.B. Notebooks und Peripheriegeräte verschiedener Hersteller ausprobieren und begutachten. Auch bei Software-Fragen wird geholfen. Wäre es bei so viel Flexibität hinsichtlich der Arbeitsplätze nicht auch angemessen, wenn die Mitarbeiter ihre eigenen Geräte mitbringen und einsetzen können? – »Das würde den Aufwand beim Support stark in die Höhe treiben«, sagt CIO Dr. Pritsch. »Lieber geben wir etwas mehr Geld für die Geräte aus und haben dann aber auch funktionierende und produktive Lösungen. Damit sind die Kosten über die Gesamtlebenszeit am Ende niedriger. Außerdem können wir nur so unsere Sicherheitsstandards halten, z.B. bei der verschlüsselten Kommunikation.«
Jobangebote+ passend zum Thema
User Experience Lab
Eine von den Bosch-Fachbereichen besonders stark nachgefragte Abteilung des IT-Campus ist das User Experience Lab. Es zeichnet sich durch seine Vielfalt von Mitarbeitern und Methoden aus. Hier arbeiten nicht nur IT-Spezialisten, sondern z.B. auch Kommunikationswissenschaftler und Psychologen. Ein Materiallager mit zahlreichen Hilfsmitteln von Lego bis zum 3D-Drucker soll die Kreaitivität fördern. Zusammen mit Kunden und Anwendern kann dort in einer frühen Projektphase anhand von einfachen Prototypen evaluiert werden, ob die angedachte Lösung in die richtige Richtung weist. Ein Computerarbeitsplatz ist mit Kameras und Eye-Tracking-Einrichtungen ausgerüstet, mit denen sich das Nutzerverhalten aufzeichnen lässt. Im Raum nebenan kann die Nutzertätigkeit live beobachtet und analyisiert werden.
Die Bosch-IT soll künftig das gleiche Portfolio abdecken, das vergleichbare Dienstleister am Markt anbieten: von Consulting über Software-Entwicklung und –Applikation bis hin zum Betrieb von Plattformen, Portalen und Betriebssystemen. Zur Beratungsleistung zählt beispielsweise, alle Bosch-Bereiche noch stärker bei der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen zu unterstützen. Eines der Herzstücke für datenbasierte Geschäftsmodelle und domänenübergreifende Anwendungen ist die eigenentwickelte Bosch IoT Cloud. Sie umfasst die technische Infrastruktur wie etwa ein eigenes Rechenzentrum sowie Plattform- und Softwareangebote für die Bereiche vernetzte Mobilität, vernetzte Industrie und vernetztes Gebäude. Aktuell laufen rund 70 Anwendungen von Bosch in der eigenen Cloud. Zukünftig werden neben IT-Partnern auch Kunden von Bosch die Cloud nutzen können.
Auch andere Konzerne haben entdeckt, dass IoT, Cloud und Digitalisierung Schlüsselelemente künftigen Geschäftserfolgs sind. So hat Siemens z.B. seine Mindsphere Cloud auf den Weg gebracht und IBM verfolgt mit dem Watson IoT Center in München einen ähnlichen Ansatz der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Kunden. Werden die Konzerne dadurch immer austauschbarer? – Prof. Dr. Asenkerschbaumer glaubt das nicht: »Was uns auszeichnet, ist die Kombination aus IT-Know-how und dem domänenspezifischen Anwendungswissen.«
Der Bosch IT-Campus von innen

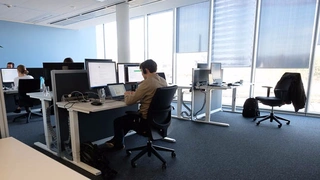

- Der neue Bosch IT-Campus von innen
- Keine feste Sitzordnung