Prof. Leo Lorenz im Interview
Faszination Leistungselektronik
Seit Ende der 1970er-Jahre hat Leo Lorenz maßgeblich am MOSFET, am IGBT, am CoolMOS und an der SiC-Diode mitgewirkt. Wir fragten ihn, wie er zur Leistungselektronik kam, was ihn bis heute fasziniert und welche Trends er sieht. Und wie kann man mehr junge Leute für die Leistungselektronik begeistern?
Elektronik: Soviel ich weiß, haben Sie einen etwas ungewöhnlichen Bildungsweg eingeschlagen. Erzählen Sie uns dazu ein bisschen.
Leo Lorenz: Ich bin nicht den direkten Weg über das Gymnasium gegangen, sondern hatte zuerst eine dreieinhalbjährige Lehre zum Anlagenelektroniker absolviert. Parallel dazu hatte ich mich über die Berufsaufbauschule in Abendkursen auf die Mittlere Reife vorbereitet, die dann die Zugangsvoraussetzung für die Ingenieurschule war.
Mit dieser vorhergegangenen Ausbildung – praxisnahe Ausbildung im Handwerksberuf gepaart mit dem Grundlagenwissen der Berufsaufbauschule – hatte ich die Ingenieurschule sehr gut abgeschlossen. Das alles hatte mich motiviert, mein theoretisches Wissen durch ein weiterführendes Studium an der Universität damals zum Diplom-Ingenieur zu ergänzen. Auch die hohe Zahl der Studienabbrecher mit Abitur im Fach Elektrotechnik an den Universitäten hatten mich auf dieses weiterführende Studium neugierig gemacht.
Daher hatte ich an der TU Berlin weiterstudiert und dort mein Elektrotechnik-Studium zum Diplom-Ingenieur mit sehr gutem Erfolg absolviert. Anschließend arbeitete ich drei Jahre im Forschungsinstitut der AEG in Berlin. Im Jahr1979 ging ich dann nach München, um zu promovieren.
Wie kamen Sie zur Leistungselektronik?
Als ich studierte, war die Halbleitertechnik – genauer gesagt: die Bipolartechnik – noch etwas ganz Neues. Wie konnte so ein Halbleiterschalter, an dem man einen Steuerstrom von einem Ampere anlegt, im Leistungskreis einen Strom von hundert Ampere oder mehr schalten? Das faszinierte mich in gleicher Weise wie die Halbleiterzellenstrukturen selbst. Wie ist so ein Halbleiter aufgebaut, was bedeutet Dotierungsprofil, warum muss man dotieren und warum ist Silizium ein so wichtiges Grundmaterial und so weiter. Da gab es viele Fragestellungen, die mich sehr interessierten.
Jobangebote+ passend zum Thema
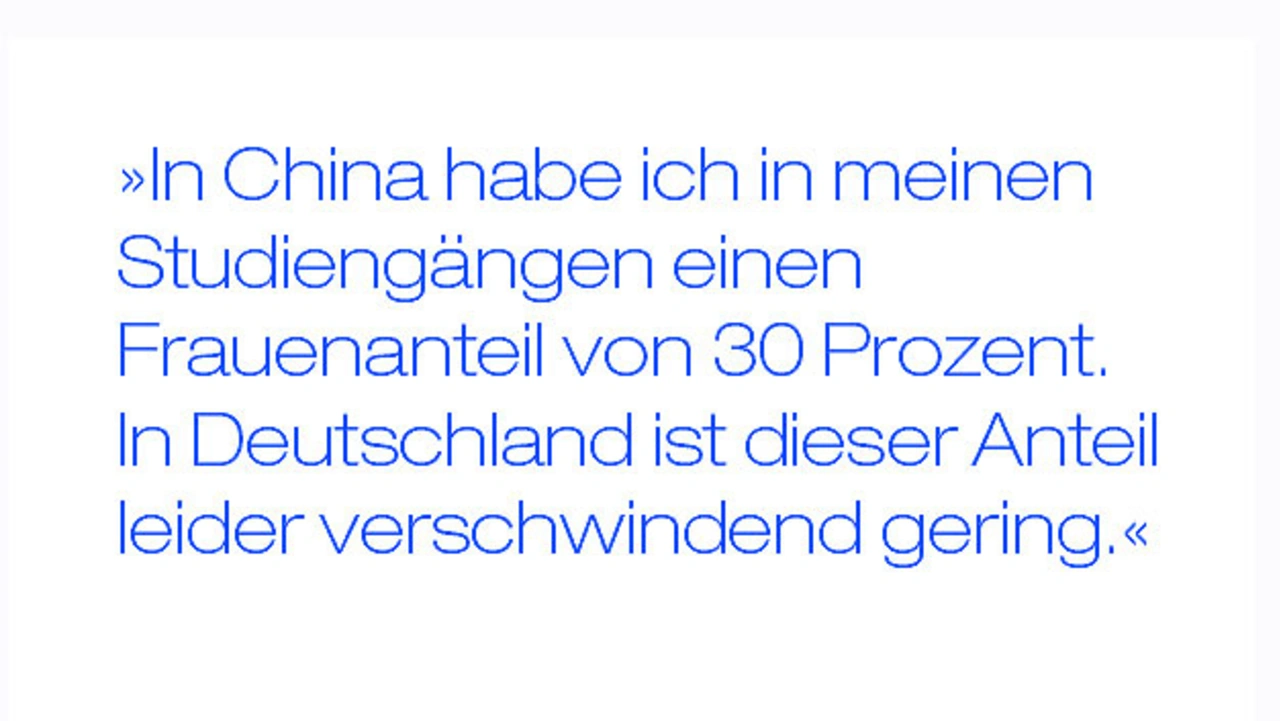
Bereits an der Ingenieurschule hatte ich jüngere Dozenten, die uns die Diode, den Thyristor und den Bipolartransistor näherbrachten. Aber zusätzlich ausschlaggebend für mich war die Vorlesung von Professor Heumann an der TU Berlin, der auch das damals bekannteste Forschungsinstitut für Leistungselektronik in Deutschland bei der AEG in Berlin leitete. Seine Vorlesung war wirklich großartig, da er neben den Grundlagen auch über die neuesten Forschungsergebnisse aus der Leistungselektronik referierte und so verstand, die Studierenden mitzunehmen.
Basierend auf den neuen Leistungshalb-leiterschalter-Technologien entstanden zur damaligen Zeit auch viele Schaltungs-topologien wie zum Beispiel die McMurray-Schaltung und viele mehr, die heute noch Grundlage für viele leistungselektronische Stellglieder sind: Der Thyristor im zwangskommutierten Einsatz, gefolgt vom GTO-Thyristor und dann dem Bipolartransistor, die heute noch die Basis für Motorsteuerungen sind.
Als interessierter Absolvent dieser Vorlesung fragte ich Professor Heumann, ob ich an seinem Institut bei der AEG meine Studien- und Diplomarbeit machen könne. Im Anschluss meines Studiums hatte ich drei Jahre als »Junior Researcher« unter seiner Leitung am AEG-Forschungsinstitut gearbeitet.
Was fasziniert Sie an der Leistungselektronik so?
Zum einen ist das der Halbleiter an sich. Nicht nur der Leistungshalbleiter, sondern auch die IC-Technologien und deren extreme Leistungsfähigkeit ganz besonders, wenn man an das Moore‘sche Gesetz denkt – eine Verdopplung der Zellendichte auf gleicher Chipfläche alle zwei Jahre oder die Subnanostrukturen in der Zukunft, die langfristig auch für die übernächste Generation der Leistungshalbleiter notwendig werden.
Das ist das Rohmaterial der Zukunft und die Basis für alles. Kein Fortschritt ohne diese Technologie, kein Auto, keine Digitalisierung und kein Gerät. Der Leistungshalbleiter ist Technologietreiber für die Themen Wirkungsgrad, Leistungsdichte, Systemlebensdauer, Digitalisierung und so weiter. Gerade durch die Elektromobilität, die Industrieautomatisierung und Energiefragen rücken diese Themen wieder in den Fokus. Das alles sind Themen, die mich bei der Leistungselektronik faszinieren.
Danach waren Sie bei Siemens Halbleiter, woraus später Infineon wurde. Soviel ich weiß, haben Sie bei den Power-Modulen wesentliche Entwicklungen vorangetrieben. Erzählen Sie doch mal aus dieser Zeit.
Als ich 1979 nach München kam, um zu promovieren, entschied ich mich für den Leistungs-MOSFET als Thema. 1979 war die Geburtsstunde dieser damaligen Technologiewende von der Bipolartechnik zu den feinstrukturierten MOS-gesteuerten Bauelementen. Um einen kompetenten Diskussionspartner zu haben, ging ich zu Siemens ins Münchner Forschungslabor und fragte, ob ich bei der Entwicklung des MOSFET mitmachen könne. Das stieß sofort auf positive Resonanz. Im Rahmen der Promotion entwickelte ich ein Simulationsmodell für den Leistungs-MOSFET. Als ich dann 1984 bei Siemens anfing, war meine erste Aufgabe, einen MOS-gesteuerten Halbleiter für die Motorsteuerung im Spannungsbereich 1200 Volt zu entwickeln. MOSFETs als unipolare Bauelemente waren dafür ungeeignet, da diese aus ökonomischen Gesichtspunkten niemals bis 1200 Volt gehen würden.
Aber auch der klassische Bipolartransistor war für Motorsteuerungen nur begrenzt einsetzbar, weil sein sicherer Arbeitsbereich nicht groß genug war. Also ging es darum, den gut steuerbaren MOS-Transistor mit dem Bipolartransistor zu »verheiraten« – den sogenannten BiMOS-Schalter. Die Überlegung war, die feinen MOSFET-Strukturen, die wir bei Siemens fertigen konnten, zu nutzen, um neuartige Bipolartransistoren mit einer Basisweite von nur drei Mikrometern zu prozessieren; klassische bipolare Bauelemente hatten damals Basisweiten von 200 bis 300 Mikrometer. Mit dem Einsatz dieser feineren Strukturen wären dann die störenden Einschnüreffekte weg. Wir nannten diese Technologie dann SIRET – Siemens-Ring-Emitter-Transistor. Das war damals ein völlig neuer Ansatz, ein großartiges Bauelement – auch heute noch. Die ganzen Entlastungsnetzwerke waren damit hinfällig, und der SIRET-Schalter hatte einen sicheren Arbeitsbereich, wie man ihn vom MOSFET kannte.
Parallel zum SIRET und mit dem Know-how der MOS-Strukturen wurde jedoch auch der IGBT entwickelt. Bei Siemens haben wir damit zwar experimentiert, setzten allerdings zunächst auf den SIRET als Eigenentwicklung. Wegen seiner exzellenten Performance versuchten wir, diesen weltweit in leistungselektronische Umrichter einzudesignen, aber die Japaner konnten mit all ihrer Marktmacht damals in der ersten Hälfte der 1980er-Jahre den IGBT durchsetzen. Da der IGBT als MOS-gesteuertes Bauelement dem Bipolartransistor überlegen war und vom Markt sehr schnell akzeptiert wurde, mussten wir den SIRET wieder abkündigen, und ich beschäftigte mich in den folgenden Jahren mit dem IGBT.
Da ich von der Anwendungsseite, also von der Motorsteuerung, kam, hatte ich in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterentwicklern vorgegeben, welche Eigenschaften diese Bauelemente haben müssen, um Vorteile in dieser Applikation zu haben. Ich befasste mich auch viel mit der Aufbau- und Verbindungstechnik, denn die war bei einem MOS-gesteuerten Bauelement wie dem MOSFET oder IGBT völlig anders als bei einem klassischen Bipolartransistor für die Motorsteuerung.
Was werden Ihrer Meinung nach die technologischen und kommerziellen Herausforderungen für die Leistungselektronik in den nächsten fünf bis zehn Jahren sein?
Die technologische und kommerzielle Entwicklung beginnt immer mit dem Halbleiter. Auch wenn die Wide-Bandgap-Halbleiter – also Siliziumkarbid und Galliumnitrid – viel Beachtung finden und zunehmend eingesetzt werden, wird Silizium auch in absehbarer Zukunft das aus wirtschaftlicher Hinsicht wichtigste Halbleitermaterial für die Leistungselektronik bleiben. Und sowohl bei IGBTs als auch bei Superjunction-MOSFETs sehe ich noch viel Weiterentwicklungspotenzial. Aber gleichzeitig werden sich die Wide-Bandgap-Halbleiter natürlich in ihrer Performance, Lebensdauer und den Herstellkosten deutlich verbessert und als Konsequenz Marktanteile gewinnen – keine Frage.
Neben der Weiterentwicklung der Leistungshalbleiter sehe ich die Systemintegration von Halbleitern zusammen mit den relevanten passiven Komponenten zu »Power-Embedding-Subsystemen« und Umrichtern bis hin zur vollständigen Motorintegration. Auch das Definieren und Realisieren von leistungselektronischen Grundbausteinen – Power-Electronic-Building-Blocks genannt – sehe ich als wichtige Zukunftsthemen. Solche standardisierten Schaltzellen lassen sich ähnlich wie Lego-Steine zu leistungselektronischen Systemen zusammensetzen, die sich bei der Spannung und/oder beim Strom quasi beliebig skalieren lassen. Multi-Level- und Multi-Phasen-Umrichter sind da erste Ansätze. Voraussetzung für die Optimierung solcher Systeme ist die Anwendung von Design-Automation und Digital Twins. Zukünftig werden sich die Unternehmen daher über Software und den Einsatz künstlicher Intelligenz differenzieren.
Ein dritter Punkt bei der Standardisierung betrifft die Elektromobilität. Heute besitzt ein solches Fahrzeug noch drei getrennte Umrichter: den Antriebsumrichter, den On-Board-Charger für das Laden der Batterie und den DC-DC-Wandler, der die hohe Batteriespannung von 400 oder 800 Volt auf 12 Volt wandelt, um damit die Fahrzeugelektronik zu versorgen. Diese drei Funktionen werden zukünftig in nur einem System konsolidiert. Das ist ein typisches Beispiel, und viele derartige Standards werden bei der Fabrikautomatisierung und der Energieübertragung folgen, um Material einzusparen und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern.
Gibt es auch kommerzielle Herausforderungen für die Leistungselektronik?
Da sehe ich die Lieferketten und die Materialbeschaffung als die großen Sorgenkinder. Es gibt beispielsweise Einschätzungen, wonach Kupfer in 40 Jahren ausgehen könnte. In einem Halbleiter, dem Leistungsmodule und für dessen Fertigung ist eine Vielzahl verschiedener Materialien nötig.
Gleiches gilt für Siliziumkarbid. Wenn dieser Markt tatsächlich so stark wachsen sollte, wie manche prognostizieren, haben wir ein Problem mit Substraten – sowohl von der schieren Menge her als auch von der Qualität. Sehe ich mir die Defekte bei einem 300-Millimeter-Wafer aus Silizium an, da sind da vielleicht drei »Sterne«, sprich: Kristalldefekte, drauf. Bei Siliziumkarbid sehe ich einen »Sternenhimmel«, und man fragt sich, wie sich daraus noch irgendein vernünftiges Bauteil mit einer vernünftigen Ausbeute fertigen lässt.
Und noch ein Thema: Second-Sourcing. Das habe ich bei CoolMOS erlebt. Ein super Bauelement, das war den Kunden sofort klar, aber die nächste Frage war gleich: »Gibt es eine Second Source?« Auch das muss abgedeckt sein. Und in der heutigen Zeit, in der sich die geopolitischen Gegebenheiten verändern, dann wird diese Frage sogar noch drängender.
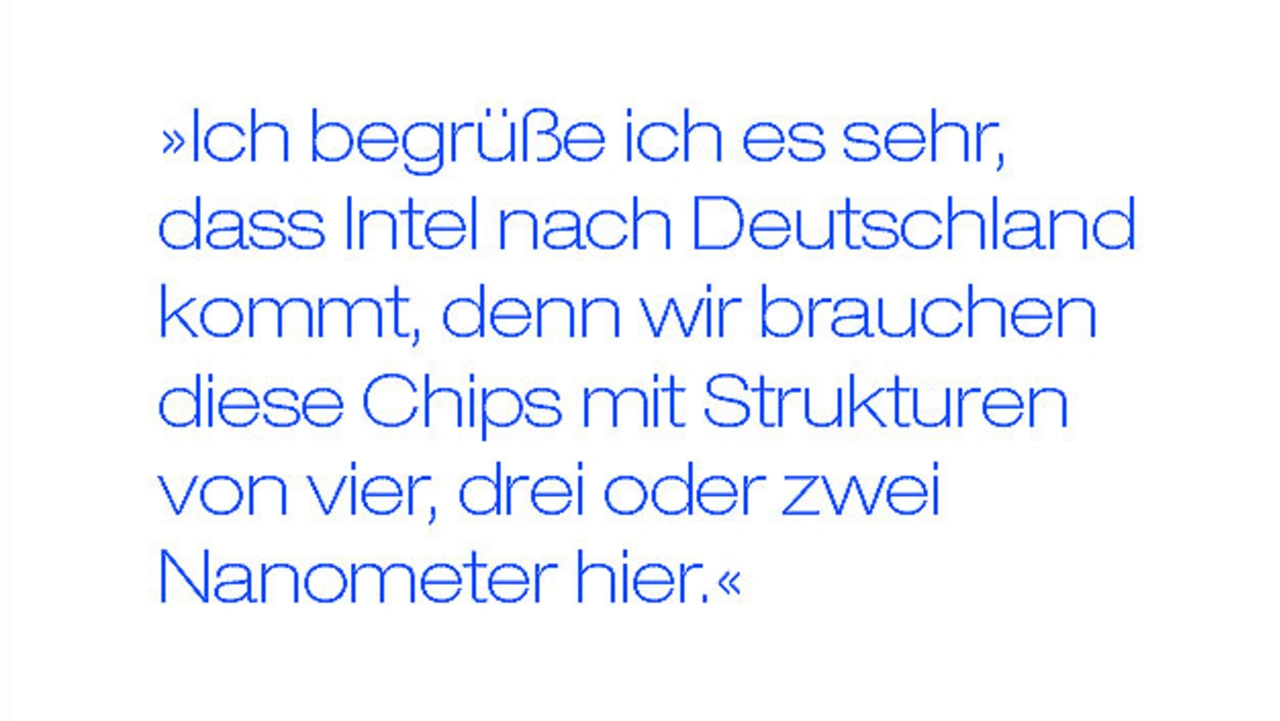
Bislang war ja der Wirkungsgrad bei Umrichtern der treibende Faktor. Ändert sich das?
Ganz bestimmt. Umrichter haben heute Wirkungsgrade von 98,5 Prozent bei Silizium und 99,5 Prozent bei Siliziumkarbid. Da ist nicht mehr viel Verbesserungspotenzial drin. Nun rückt die Leistungsdichte als treibender Faktor in den Fokus. Daher wird es zukünftig mehr um die Systemintegration von Halbleitern sowie deren Aufbau- und Verbindungstechnik im Zusammenspiel mit den passiven Komponenten gehen. Oder denken Sie an die 7- oder 9-Level-Umrichter mit Galliumnitrid- Bauelementen – da verkleinert sich das nachgeschaltete Netzfilter um den Faktor 10. Im Grunde genommen verschwindet es.
Über die extrem hohen Schaltfrequenzen, die mit den neuen Bauelementen möglich sind, lässt sich das Gesamtsystem – dort, wo auch passive Komponenten zur Energiespeicherung und Filter notwendig sind – optimieren und elektrische Antriebe weiterentwickeln. Die große Herausforderung ist allerdings die immer höhere Betriebstemperatur, die Wärmeabfuhr, die Isolationsfestigkeit, die Robustheit und Lebensdauer der Komponenten sowie die Beherrschung der extrem hohen Werte des du/dt und di/dt im Gesamtsystem.
Allerdings lassen diese Themen sich nicht mehr nur experimentell untersuchen. Um all die Einflussfaktoren und wechselseitigen Beeinflussungen überhaupt verstehen zu können, brauchen wir den digitalen Zwilling, die Simulation und automatisierte Entwurfswerkzeuge. Dies wird auch nötig sein, um darüber hinaus die Entwicklungszyklen zu verkürzen.
Apropos digitaler Zwilling – wird die Leistungselektronik als Multi-Domain-Technologie nicht auch weiteren Nutzen aus dem breit angelegten Einsatz von künstlicher Intelligenz und Big Data ziehen?
Da sehe ich zwei Ansatzpunkte – den Blick nach innen in den Umrichter hinein und den Blick nach außen auf die Anwendung. Beim Blick nach innen geht es beispielsweise um das Monitoring des Antriebsumrichters. Möchte man im Betrieb immer näher an die physikalischen Grenzen der Halbleiter gehen und diese immer kleiner machen, müssen alterungsrelevante Parameter wie Temperatur, Strom und Spannung und deren Anstiegsgeschwindigkeiten sowie Umwelteinflüsse wie aggressive Gase, Feuchteentwicklung, Ionen-Migrationseffekte ständig abgefragt werden. Mithilfe von Datenanalysen lassen sich dann Effekte wie Delaminationen oder Korrosionsansätze erkennen und daraufhin Serviceeinätze planen – Stichwort Predictive Maintenance.
Beim Blick nach außen geht es um neue Dienstleistungen. Ein einfaches Beispiel: Heute steuert der Umrichter den Motor und der Motor den zu verrichtenden Prozess. Heute verkauft Siemens beispielsweise intelligente Umrichter, aber in Zukunft will man vielleicht Drehmoment, Motordynamik oder Prozess-Performance verkaufen. Damit muss die Maschine, gefolgt vom Umrichter, lernfähig werden. Sie sammelt Daten aus der Anwendung und mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz sich selbst zu optimieren.
Wie beurteilen Sie die Chancen für Europa als Fertigungsstandort für Halbleiter angesichts des EU Chips Act im Vergleich zu den Chip Acts, die in vielen Weltregionen nun aufgelegt werden?
Der EU Chips Act ist ein wichtiger Schritt, der hoffentlich große Veränderungen mit sich bringt. Ich bin immer wieder in Gesprächsrunden in den Ministerien eingebunden. Dort stelle ich leider fest, dass einige Halbleiterexperten nur ihre eigene kleine Welt im Blick haben. So sagen IGBT-Spezialisten beispielsweise, wir hier in Europa seien dort so deutlich führend – wir bräuchten keine Fertigung von Halbleitern mit feinsten Strukturen hier. Für die Leute in diesem Bereich ist diese Sichtweise auch in Ordnung, aber das sind nur fünf oder sechs Prozent des globalen Halbleitermarktes! Wir müssen aufpassen, dass wir die politischen Entscheidungsträger nicht falsch beraten, sodass diese zu dem Schluss gelangen, wir bräuchten hier in Deutschland und Europa keine Leading-Edge-Halbleiterfertigung, wie es zum Beispiel für die Hochperformance-ICs notwendig ist.

Ich habe immer schon für eine Leading-Edge-Halbleiterfertigung hier in Deutschland plädiert, weil wir hier in der Systemtechnik extrem gut sind. Wir wissen beispielsweise sehr genau, welche Systeme wir im Auto der Zukunft brauchen, welche Funktionen sich integrieren lassen und was dafür nötig ist. Wir können die Komplexität dieser zukünftigen Chips sehr gut beschreiben und entwickeln. Und genau dafür brauchen wir Halbleiter mit extrem feinen Strukturen. Deswegen begrüße ich es sehr, dass Intel nach Deutschland kommt, denn wir brauchen diese Chips mit Strukturen von vier, drei oder zwei Nanometer hier. Wenn jetzt noch TSMC als Auftragsfertiger hier investieren würde, wäre das wirklich sehr gut. Solange wir diese Technologien nicht im eigenen Land haben, werden wir auch keine qualifizierten Ingenieure ausbilden.
Selbstverständlich müssen wir nicht alle ICs hier in Deutschland fertigen, aber für die sehr leistungsfähigen CPUs, die für die Fabrikautomatisierung, die Elektromobilität, die Kommunikation, die Smart City und so weiter notwendig sind, brauchen wir die Basistechnologien und das Fertigungs-Know-how.
Aber sind so geringe Strukturbreiten auch für die Leistungselektronik wichtig?
In Zukunft schon. Bei den kommenden Tri-Gate-Multikanal-GaN-Bausteinen brauchen wir Strukturen im einstelligen Nanometer-Bereich.
Bei Ansiedlungen geht es einerseits um Fördergelder, andererseits aber auch um Fachkräfte. Die müssen ja auch vorhanden sein. Ich erinnere mich an eine Diskussion, die ich bei einer dieser Gesprächsrunden mit einem Intel-Manager führte. Er meinte, dass Intel bei der Standortsuche abhängig vom Land unterschiedliche Fördersummen von der EU bekäme, da diese die strukturschwachen Länder stärker fördert als beispielsweise Deutschland. Daraufhin sagte ich, dass er dort aber keine gut ausgebildeten Fachkräfte für die Halbleiterfertigung und noch viel weniger Systemkompetenz für die Anwendung und fertigungsnahe Infrastruktur bekäme. Am ehesten findet er solche Leute in Deutschland. Fördergelder allein lösen nicht diese Probleme.
Umfragen haben ergeben, dass die Elektrotechnik als Studienfach ein schlechtes, angestaubtes Image bei jungen Menschen hat. Wie könnte man diese erreichen und sie für die Elektrotechnik und im Besonderen für die Leistungselektronik begeistern?
Lassen Sie mich zu meinem eingangs erwähnten Bildungsweg zurückkommen. Wenn man so einen Weg geht wie ich – zunächst über eine Lehre –, dann hat man eine wichtige Basis für das alltägliche Leben allgemein, aber auch für den Ingenieurberuf. Man lernt von der ersten Stunde an, in vielerlei Hinsicht praktisch zu arbeiten, Schaltungen zu entwickeln und zu realisieren. Zu meiner Zeit hat jeder versucht, beispielsweise Lichtorgeln für die nächste Party zu basteln oder auch ein einfaches Oszilloskop, um Schaltungen selber bewerten zu können. Und das fehlt heute den meisten Studenten, die ja meist den geradlinigen Weg übers Abitur gehen. Gymnasium ist reines Lernen. Dann kommt das Studium – das ist Grundlagen zu verstehen und Theorie zu erlernen. Und dann kommen die jungen Ingenieure in die Industrie und sollen dort ein Produkt realisieren. Diese Fertigkeit fehlt leider vielen, wie ich das immer wieder feststellen musste.
Nach dem Diplom war ich bei AEG in das Projekt Cahora-Bassa-Talsperre eingebunden. Ich entwickelte damals ein Simulationsmodell für einen Thyristor, und dann wollte ich natürlich selbst sehen, ob dieses mit der Realität übereinstimmt. Also war ich drei Monate vor Ort in Mosambik und habe gemessen. Das war eine rein praktische Übung. Ich konnte mit sehr erfahrenen Inbetriebnahme-Ingenieuren zusammenarbeiten, um zu verstehen, wie derartige Großanlagen funktionieren. Gleichzeitig konnte ich auch lernen, wie weit mein Simulationsmodell – das war mehr theoretische Arbeit in meinem Büro in Berlin – von der gemessenen Schaltkurve abweicht. Diese Praxis hat mir bei meiner Promotion, die ich im Anschluss begann, geholfen.

Das hat also etwas mit unserem Schulsystem zu tun. Was müsste sich Ihrer Meinung dort ändern, um mehr junge Leute für die Laufbahn als Ingenieur zu begeistern?
Immer wieder bekomme ich zu hören, dass die Elektrotechnik ganz nahe am Physikstudium sei, das als hartes und langes Studium bekannt ist. Außerdem kann man bei der Elektrotechnik nichts sehen. Das meine ich ganz buchstäblich. Strom kann ich nicht sehen. Daher ist bei vielen Studenten, die sich für Ingenieurwissenschaften interessieren, der Maschinenbau immer noch beliebter. Da kann man was sehen und anfassen, es »begreifen«. Das ist anscheinend ein großes Thema für viele.
Ein anderer Punkt, der mir am Herzen liegt, ist, dass wir 50 Prozent der Jugendlichen gar nicht erreichen: die Mädchen. Und an die kommen wir wohl nur über die Lehrerschaft. Wir von der ECPE, der VDE und all die anderen Interessenvertreter gehen punktuell immer mal wieder an Schulen, aber das ist nicht flächendeckend und nicht strukturiert. Ich wünsche mir, dass wir an allen Gymnasien ein oder zwei Lehrer hätten, die das Thema Elektrotechnik geschmackvoll und mitreißend rüberbringen können. Und da geht es nicht nur um junge Frauen – wir brauchen auch dringend mehr junge Männer, die sich für diesen Beruf entscheiden.
Sieht es da in China anders aus?
Absolut. Dort habe ich in meinen Studiengängen einen Frauenanteil von 30 Prozent – Master-Studentinnen und Doktorandinnen. In China hat bis heute der Ingenieurberuf einen viel höheren gesellschaftlichen Stellenwert als hier. Hier ist es eher Jurist, Arzt oder studiert Betriebswirtschaft oder Sozialwissenschaften. Und ein Kind aus einer Arztfamilie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls Arzt oder Ärztin.
In China haben die Staatsführung und die Minister zu vermutlich 90 Prozent eine Ausbildung als Ingenieur. Ein befreundeter Professor erinnert sich noch, dass Chinas Staatspräsident Xi Jinping bei ihm Chemieingenieur gelernt hat. Wenn wir uns ansehen, wer bei uns in Deutschland die politischen Entscheidungsträger sind, dann finden sich da Juristen, Politologen, Lehrer – keine Ingenieure.
Wie sieht es denn bei Ihnen in der Familie aus? Konnten Sie Ihrer Tochter den Ingenieurberuf schmackhaft machen?
Leider nein. Sie studierte Politikwissenschaften. Und als sie fertig war, fing sie im Medienbereich an und musste dort extrem hart für extrem wenig Geld arbeiten und bekam immer nur projektweise befristete Verträge. Nach etwa fünf Jahren kam sie dann zu mir und fragte mich, ob ich sie nicht bei Infineon unterbringen könne. Dann kam sie dort in die Unternehmenskommunikation und war höchst begeistert, weil sie endlich einen festen Vertrag mit einer vernünftigen Vergütung hatte. Und meine Tochter ist da kein Einzelfall, dass junge Leute lange studiert haben, nur um festzustellen, dass das dann doch nicht die beste Wahl war, wenn es um die Arbeitslast, Weiterentwicklung und die Bezahlung geht. Der Ingenieurberuf würde all das mit sich bringen. Aber um da die Weichen richtig stellen zu können, müsste man viel früher die Schülerinnen und Schüler erreichen.
Noch eine indiskrete Frage zum Schluss: Was war in Ihrer beruflichen Laufbahn der größte Fehler, Irrtum oder Fehleinschätzung?
Fehler waren bestimmt einige dabei, das gehört zum Leben dazu. Ohne Fehler kein Fortschritt. Aber den gleichen Fehler sollte man möglichst nicht öfters tun.
Aber Fehleinschätzungen gab es gleich mehrere Male. Bei Siemens waren wir technikgetrieben. Als wir dort den MOSFET vorstellten, meinten wir, das Bauteil sei so überragend, dass es die Bipolartransistoren ersetzen würde. Daraufhin kündigten wir bei Siemens die Bipolartransistoren ab – mitten in der Anlaufphase für den MOSFET. Wir hatten einen bestimmten Umsatz für das Jahr1990 prognostiziert. Den haben wir auch erreicht – aber mit acht Jahren Verzögerung. Ganz zu schweigen von den verärgerten Bipolar-Kunden, die wir in unserer Euphorie einfach an die Wand gefahren haben, als wir die komplette Bipolartechnik abgekündigt haben.
Und genau das Gleiche ist uns bei der Einführung des CoolMOS passiert. Der Umsatz ist gekommen – aber fünf Jahre später. Beim IGBT war es leider ähnlich. Daher gehe ich heute davon aus, dass die Wide-Bandgap-Halbleiter erst frühestens Mitte des nächsten Jahrzehnts genauso viel Umsatz machen werden wie Leistungshalbleiter aus Silizium. Andere meinen, das wäre schon Ende dieser Dekade der Fall. Aber ich bin ein gebranntes Kind in dieser Hinsicht.
Professor Lorenz, vielen Dank, dass sie sich die Zeit genommen haben.