Der Apple-ams-Osram-Bruch und die Folgen
Nach Apples Ausstieg: Ist microLED-Technik jetzt tot?
Welche Auswirkungen wird es auf die microLED-Technik nehmen, dass Apple die Zusammenarbeit mit ams Osram aufgekündigt hat? Ist das ein schwerer Schlag für die microLED-Technik insgesamt, ist sie gar tot?
Für ams Osram sieht es so aus. Das Unternehmen war von der plötzlichen Entscheidung von Apple am Mittwoch letzter Woche wie vom Donner gerührt. »Wir stehen unter Schock«, erklärten der CEO Aldo Kamper und der CFO Rainer Irle in einer kurzfristig angesetzten Ad-hoc-Pressekonferenz. Es hätte gute Fortschritte auf technischer Ebene gegeben, die plötzliche Kehrtwende konnte sich Aldo Kamper nicht erklären.
Apple mal wieder als Vorreiter?
Eine Botschaft dürfte Apple an die Verfechter der microLED-Technik jedenfalls gesendet haben: So schnell wie gedacht wird sie sich auf dem Privatkunden-Markt nicht durchsetzen. Laut Analysten der Yole Group hat Apple bereits den größten Teil des am microLED-Projekt beteiligten Teams entlassen, rund 350 Mitarbeiter. Immerhin 3 Mrd. Dollar soll Apple in dem Projekt versenkt haben. Schon über die vergangenen Jahre hatte sich abgezeichnet, dass trotz hoher Geldbeträge, die in die Entwicklung der microLED-Technik geflossen sind, die Fortschritte nicht den ursprünglichen Hoffnungen entsprachen.
»Auf der SPIE Photonics West, die gerade Ende Januar in San Francisco stattgefunden hat, war jedenfalls die microLED-Euphorie, die noch vor zwei Jahren geherrscht hatte, erheblich abgeflaut«, erklärte Peter Weigand gegenüber Markt&Technik. Er ist CEO von TriLite, einen Startup mit Sitz in Wien, der sich der Entwicklung der Laser-Beam-Scanning-Technik (LBS) für den Einsatz in AR-Brillen verschrieben hat und deshalb der microLED-Technik grundsätzlich skeptisch gegenübersteht.
Ganz ähnlich war der Eindruck von Ulrich Hofmann, CEO von OQmented, die ebenfalls an der LBS-Technik arbeitet. Schon auf der CES Anfang Januar in Las Vegas habe er rege Nachfrage nach den eigenen Systemen verspürt. Zudem habe Barry Silverstein, Optics and Display Research Senior Director der Reality Labs von Meta, in einer Keynote erkennen lassen, dass er die Laser-Techniken für vielversprechender hält als OLEDs, LCoS und microLEDs.
OLEDs vs. microLED-Technik
Doch auch microLED-Spezialist Dr. Uwe Vogel, Head of Microdisplays & Sensors am Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS hat Bedenken: »Die Reife der Technologie ist noch nicht weit genug, vor allem bei hohen Pixeldichten und Vollfarbe. Daher mangelt es an Ausbeute in der Fertigung, das wird noch weitere Jahre benötigen. OLEDs sind da einfach viel weiter und günstiger.« Doch er ist sich sicher, dass die microLED-Technik in Mikrodisplays für bestimmte Einsatzfälle auf jeden Fall nützlich sei. Beispiele seien etwa Head-up-Displays in Autos und in Flugzeugen sowie mobile Mikro-Projektoren.
Die microLEDs stehen zwei grundsätzlichen Problemen gegenüber: Erstens die komplexe Fertigungstechnik, zweitens die hohe Leistungsaufnahme, insbesondere wenn die Pixel kleiner werden.
Vorteile der microLEDs
Doch wo sollten die microLEDs überhaupt eingesetzt werden, die ams Osram für Apple fertigen sollte? Zunächst hatte Apple an die microLED-Version ihrer Smart Watch gedacht. Heute sind sie mit OLEDs ausgerüstet. Die microLED-Versionen plante Apple ursprünglich 2024, dann 2025 und schließlich 2026 auf den Markt zu bringen – ein Zeitpunkt, der wohl nach dem Bruch mit ams Osran kaum mehr zu halten sein wird.
Für den Einsatz in Uhren spricht, dass die microLEDs sehr helle Bilder liefern, sodass die Displays auch im Freien und unter Sonnenlicht sehr gut abzulesen sind. Zweitens muss dort die Pixel-Dichte nicht sehr hoch sein. Hier genügen 100 bis 200 Pixel pro Zoll (ppi). Zum Vergleich: Auf Smartphone-Bildschirmen liegt sie bei 500 ppi. Das bedeutet, dass die Fertigungstechnik noch relativ entspannt ist, das einzelne Pixel muss nicht kleiner als 10 µm × 10 µm sein. Doch wie Dr. Uwe Vogel schon angedeutet hat – komplex und teuer ist die Fertigung dennoch, auf jeden Fall liegen die Kosten noch über denen von OLEDs.
Der Preis entscheidet
Und im Konsumgüter-Markt gilt ein unbarmherziges Gesetz: Es gibt eine magische Preisschwelle, die nicht überschritten werden darf, sonst greifen die Verbraucher nicht zu – egal wie hervorragend die technischen Werte sind. Vielleicht hat Apple ja befürchtet, dass die Preise für microLEDs in absehbarer Zeit nicht auf ein für Konsumgüter kompatibles Niveau sinken würden und deshalb die Reißleine gezogen. Yole spricht davon, dass OLEDs kontinuierlich gute Fortschritte machen und Apple für ein OLED, das in anspruchsvolle Smartphones wandert, 40 Dollar bezahle, während ein microLED-Display für die Apple Watch immer noch mit 85 Dollar zu Buche schlage.
microLED-Technik in der AR-Brille
Doch es gibt noch eine zweite Hoffnung für microLEDs: die Augmented-Reality-Brillen (AR-Brillen). AR-Brillen sollen einmal genauso wie herkömmliche Brillen oder Sonnenbrillen getragen werden. Ganz im Gegensatz zu den Virtual-Reality-Brillen (VR-Brillen), die eine künstliche Welt erzeugen, in die der Nutzer eintaucht – ohne direkten Zugang zur realen Umgebung. Wer eine AR-Brille aufsetzt, sieht dagegen die reale Welt, bekommt aber zusätzliche Informationen über virtuelle Bilder in die Gläser eingekoppelt. Sie könnten – so die Prognosen vieler Analysten – schon bald die Smartphones ablösen und in Milliarden-Stückzahlen über den Ladentisch gehen.
Dafür wären denn auch die Milliarden Dollar gerechtfertigt, die die Branchenriesen wie Apple, Google und Meta in die Entwicklung der microLED-Technik stecken. Auf den ersten Blick wäre die microLED-Technik genau das Richtige für AR-Brillen – wegen der hohen Lichtstärke. Denn erstens müssen die AR-Brillen wie die Uhren im Freien unter Sonneneinwirkung funktionieren. Zudem müssen die virtuellen Bilder über sogenannte Combiner und Waveguides in die Brillengläser eingekoppelt werden. »Der heute vornehmlich für Combiner verfolgte Ansatz durch Waveguides, die viele praktische Vorteile für eine ergonomische Brillen-Optik bieten, führt leider zu enormen optischen Verlusten, sodass deren optischer Wirkungsgrad oft nur zwischen 1 und 10 Prozent liegt, also müssen die Displays schon sehr hell sein, um dem Betrachter erkennbare Bilder zu liefern. Dazu kommt noch die begrenzte Energieeffizienz der microLED selbst, vor allem bei sehr kleinen Pixeln, die man bei AR-Brillen benötigt«, erklärt Dr. Uwe Vogel.
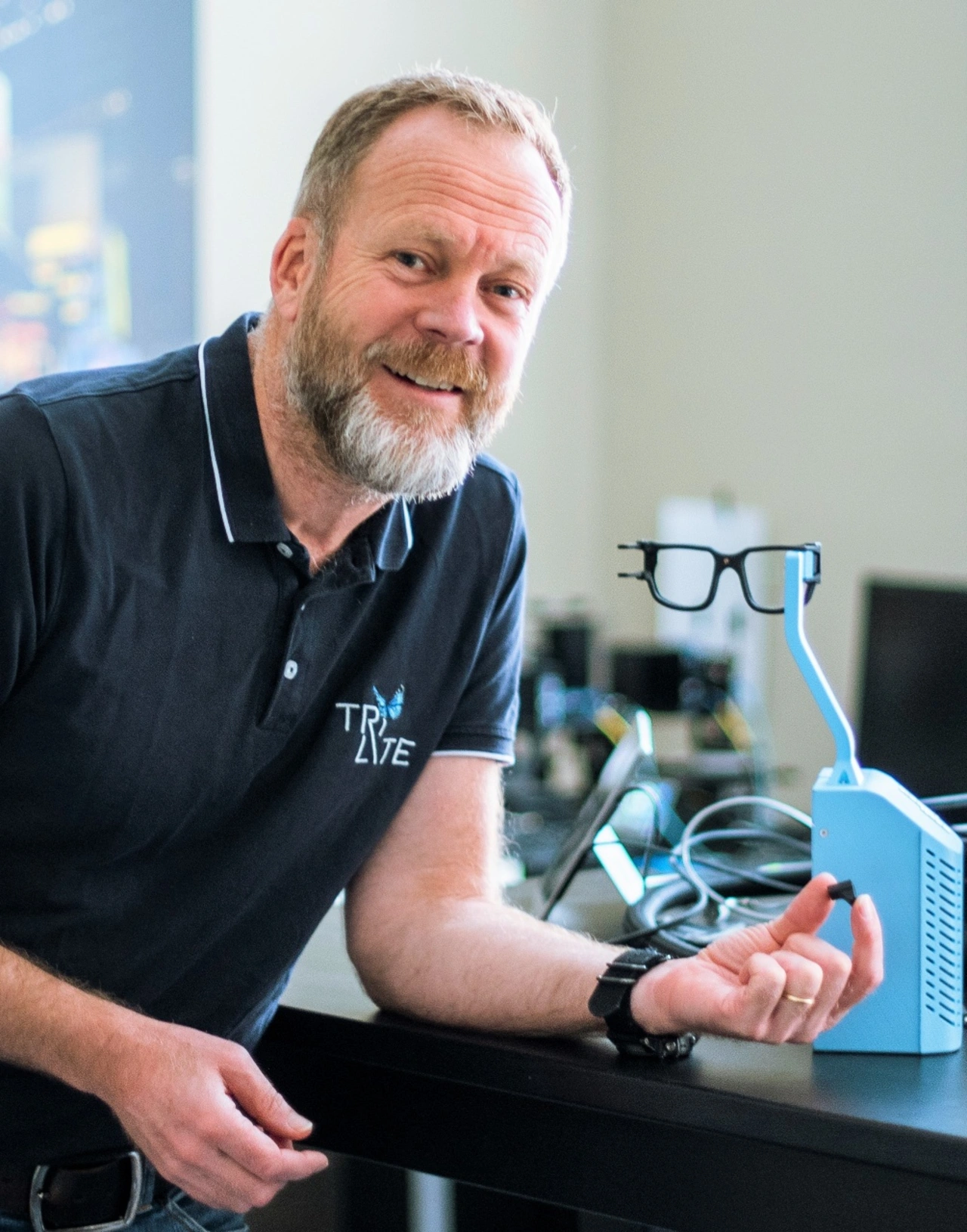
Die Fertigungstechnik ist problematisch
Somit bildet die Fertigungstechnik eine erste Hürde. Denn damit die Träger der Brille qualitativ akzeptable virtuelle Bilder eingeblendet bekommen, muss die Pixeldichte sehr hoch sein. Die 200 ppi für die Uhren reichen bei Weitem nicht, 1000 ppi müssten es allermindestens sein, besser 3000 oder gleich 10.000. Das bedeutet: Ein Pixel sollte höchstens eine Fläche von 2 µm × 2 µm oder 3 µm × 3 µm einnehmen. Die roten, grünen und blauen LEDs müssen aber oft auf verschiedenen Wafern gefertigt werden. Sie den Wafern zu entnehmen und auf das Glassubstrat zu setzen, das das Display bildet, ist hochkomplex.
Expertenmeinungen über die Zukunft der microLEDs
Ein Unternehmen, das sich intensiv mit diesem Transfer-Prozess auseinandergesetzt hat und Maschinen dafür entwickelt, ist die ProTec Carrier Systems in Siegen. Doch auch hier ist anfänglicher Begeisterung inzwischen Ernüchterung gewichen, wie CEO Sebastian Wagner gegenüber Markt&Technik erklärte. »Den Transferprozess mit einer Genauigkeit von 1 bis 2 µm durchzuführen ist derzeit wirtschaftlich für den Consumer-Markt noch nicht darstellbar. Wir verfolgen dieses Projekt deshalb nicht mehr in dem ursprünglichen Umfang.« Auch Dr. Uwe Vogel sieht das so: »Für den Transferprozess gibt es noch kein etabliertes Verfahren. Auch für die Vollfarb-Generation sind aktuell verschiedene Ansätze in Arbeit, doch wirtschaftlich ist das derzeit noch nicht konkurrenzfähig.«
Und als ob dies nicht schon genug wäre, stellt sich noch eine zweite Hürde in den Weg. Je kleiner die Pixel werden, umso mehr Strom benötigen sie, um hell genug leuchten zu können. »Denn wenn die microLEDs schrumpfen, wird das Verhältnis aus Volumen zur Oberfläche immer größer, was die Lichtintensität verringert«, sagt Peter Weigand. Damit steigt der Energiehunger der microLEDs also mit der Miniaturisierung – und das macht sie für den Einsatz in batteriebetriebenen Geräten wie AR-Brillen immer weniger geeignet.
Dazu macht Uwe Vogel folgende Rechnung auf: Wegen des beschränkten Platzes, der in den Brillenbügeln zur Verfügung steht, darf die Kapazität des Akkus 1 Wh nicht überschreiten. Die Brille sollte aber mit einer Akku-Ladung über zwölf Stunden funktionieren. Dann darf die gesamte Elektronik der Brille nur 20 mW, das Display nur 5 mW aufnehmen. »Ein Anbieter hat unlängst ein Projektionsmodul für AR-Brille mit Waveguide-Combiner mit drei monochromen Mikrodisplays (rot, grün, blau) gezeigt. Die erforderlichen microLEDs benötigen bei maximalem Lichtstrom aber alleine schon 2,4 W– eine sehr große Diskrepanz!«, so Vogel. Sein Fazit: »microLEDs werden so schnell nicht in Bereiche vorstoßen, die sie auf ein technisches und preisliches Niveau bringen, das sie für den Einsatz in VR-Brillen geeignet erscheinen lassen – das erfordert noch einiges an F&E.«
Dem können Peter Weigand von TriLite und Ulrich Hofmann von OQmented nur zustimmen, deren Unternehmen aus der Überzeugung heraus gegründet wurden, mit Laser-Beam-Scanning die bessere Technik zu bieten.

TriLite hat mit dem LBS-Projektor »Trixel 3« den kleinsten Projektor der Welt entwickelt, dessen Volumen unter 1 cm3 liegt, der weniger als 350 mW aufnimmt und das virtuelle Bild hell genug ins Auge des Betrachters projiziert, um es auch bei Sonnenschein gut erkennen zu können. Dafür hatte TriLite auf der SPIE im vergangenen Jahr den prestigeträchtigen Prism-Award verliehen bekommen.
Auf der diesjährigen SPIE hat OQmented über weitere Fortschritte in der LBS-Technik berichtet. So hat das Unternehmen eine neue Methode vorgestellt, mit deren Hilfe mindestens vier Wafer übereinander gebondet werden und damit 1000 komplette Light-Engines auf einmal gefertigt werden können. »Die Methode, auf die wir weit über 20 Patentanmeldungen eingereicht haben, senkt die Kosten für die Produktion der gesamten Light-Engine um den Faktor 10. Da haben wir gegenüber Panel-basierten Techniken auch auf dieser Ebene die Nase vorne, das geht mit Panels nicht«, so Hofmann. Außerdem hatte OQmented auf der SPIE erstmals an einem Demonstrator vorgeführt, wie sich mehrere Light-Engines zu einem Array zusammen-»stitchen« lassen. »Das ist besonders für Head-up-Displays wichtig und ist beliebig skalierbar, sogar bis hin zu Kinos und Werbetafeln.«
Auch Dr. Uwe Vogel vom Fraunhofer IPMS arbeitet an einer Alternative: »Wir haben ein Verfahren entwickelt, über das wir die Mikrodisplay-Chips so modifizieren können, dass sie zumindest semitransparent (derzeit ca. 25 Prozent) werden, mit Perspektive in Richtung 50 Prozent oder gar 75 Prozent. Damit kann der optische Combiner entfallen und die optische Effizienz verbessert sich so deutlich, dass die hohe Leuchtstärke der microLEDs gar nicht mehr benötigt wird. Damit können wir zu den kostengünstigeren OLEDs als Lichtquelle zurückkehren, und das System wird insgesamt deutlich energieeffizienter und ermöglicht Wearable-taugliche Akkulaufzeiten«, freut sich Vogel.
Auf der diesjährigen SPIE sei das Fraunhofer IPMS damit jedenfalls auf reges Interesse gestoßen.
Kann also aus der microLED für Verbraucher-Anwendungen noch etwas werden oder ist sie tot? Dr. Xioxo He, Research Director von IDTechEx, erklärte gegenüber Markt&Technik, dass nun viel davon abhänge, wie die übrigen Branchenriesen auf den Rückzieher von Apple reagieren werden. Um sich durchsetzen zu können, müsste auf jeden Fall noch viel Geld in die Entwicklung der microLEDs investiert werden. Für unwahrscheinlich hält sie das nicht, schließlich sei auch in die OLED-Entwicklung viel Geld geflossen. Und falls die Gelder nicht mehr so üppig flössen, würde die Technik zumindest in Nischenanwendungen weiterleben.
»Die Entscheidung von Apple ist ein verheerender Schlag für die Branche, selbst wenn das Unternehmen eine kleine Gruppe an Entwicklern behält, die die Forschung an microLED weiterführt. Außerdem wird Apple wahrscheinlich auch das Team weiterführen, das an einem microLED-Projekt für AR-Brillen arbeitet«, urteilt die Yole Group.
Darüber hinaus werde es für microLED-Startups in diesem Jahr schwer sein, Geld aufzutreiben. VCs und institutionelle Investoren würden sich mit Recht fragen, ob sie in eine Technologie investieren sollten, die Apple nach mehr als zehn Jahren Entwicklungszeit und Ausgaben in Höhe von 3 Mrd. Dollar begraben hat.


