Gartner Power-IC-Prognose 2015
GaN wird erst in fünf Jahren wirklich marktrevant
Fortsetzung des Artikels von Teil 1
Schnurloses Laden liegt im Trend
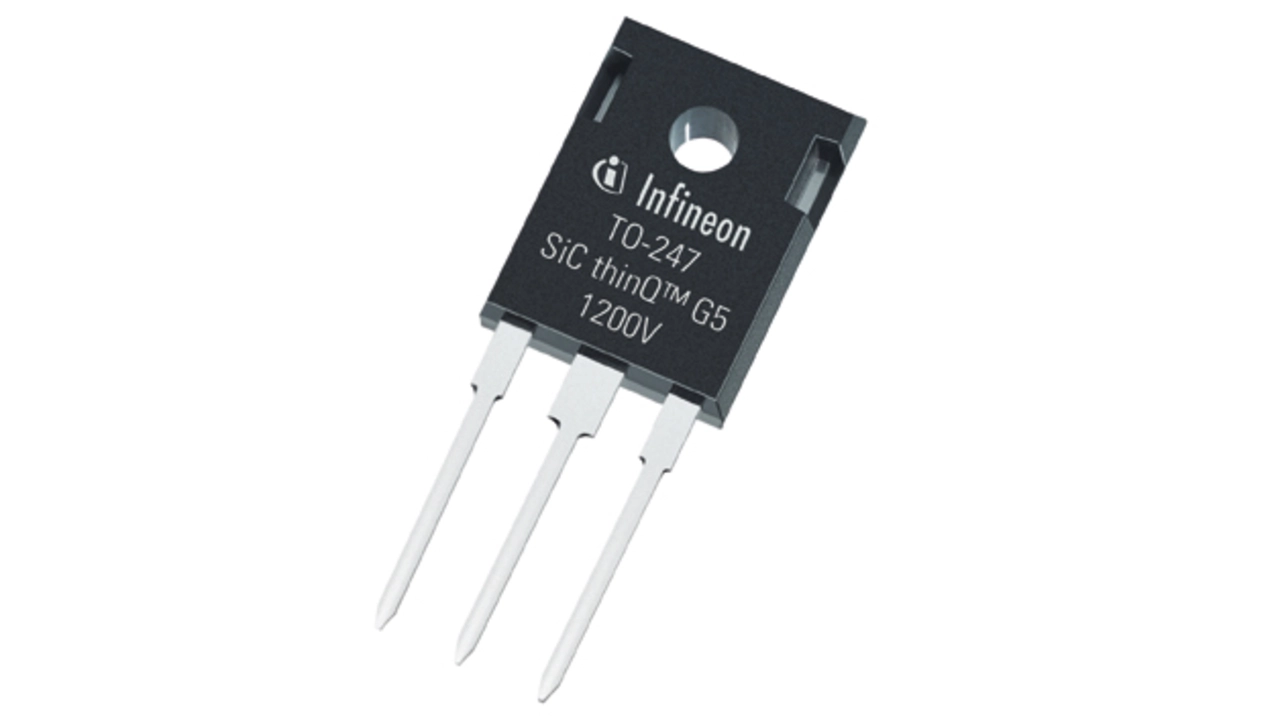
Alle Diskussionen der letzten Jahre über Wirkungsgrad und Effizienz verpuffen, wenn es um schnurloses Laden geht. Der Qi-Standard fordert eine Effizienz von 70 Prozent beim Energietransfer. Die Allianz für Wireless Power (A4WP) treibt derweil eine resonante Ladetechnologie voran, die mit deutlich höheren Frequenzen arbeitet. Zwar erleichtert die resonante Topologie die Verbindungsvoraussetzungen zwischen Power-Transmitter und Empfänger, aber dadurch wird nicht notwendigerweise die Effizienz des Energietransfers erhöht.
Die Kosten eingebauter Spulen und Empfänger für schnurloses Laden mögen bislang bei Handy-Herstellern jenseits von Nokia und LG noch nicht für marktfähig gehalten werden, aber die Hersteller von Wearable Electronics sehen in der schnurlosen Ladung eine entscheidende Möglichkeit, den Formfaktor ihrer Produkte zu verkleinern und vom ärgerlichen Mikro-USB-Steckverbinder wegzukommen. Gleichzeitig würde das die Möglichkeit bieten, das Gehäuse abdichten zu können, wenn sich Wasserdichtigkeit als wichtiges Entscheidungskriterium für den Kauf von Wearable Electronics herausstellen sollte. Qualcomm zum Beispiel nutzt eine Variation der A4WP-Resonance-Technologie, um seine Toq Smart Watch schnurlos zu laden. Es wird interessant sein zu sehen, wie Apple das Problem der schnurlosen Ladung bei seiner für dieses Jahr angekündigten iWatch gelöst hat.
Energy Harvesting wird dort am dringendsten benötigt werden, wo schnurlose Sensorknoten an Stellen im Internet of Things zum Einsatz kommen, die sich deutlich von bisherigen Anwendungen im Elektronikbereich unterscheiden. Harvester bieten sich überall dort an, wo der Wechsel einer Batterie kompliziert und aufwändig wäre. Zwar bietet eine Knopfzelle eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren, aber es gibt eben noch eine ganze Reihe anderer Energiequellen, die sich zur Versorgung nutzen lassen, wie etwa Vibration, Bewegung oder Temperaturunterschiede. Unglücklicherweise befindet sich die Entwicklung von Energy-Harvesting-Lösungen immer noch in den Kinderschuhen, und es dürften nach Einschätzung von Gartner noch fünf bis zehn Jahre Entwicklung nötig sein, bis diese Technologie Mainstream-fähig ist. Das Problem der aktuellen Energy-Harvester besteht vor allem darin, dass sie eine relativ große Oberfläche benötigen, um zumindest ein minimales Maß an Energie zu erzeugen (20 mW). Dies gilt für Ambient-Light-Harvesting, wo auf Raumbeleuchtung ausgerichtete Solarzellen eingesetzt werden, und für Thermal-Energy-Generatoren, die versuchen, zwischen heißen und kalten Oberflächen in Sandwich-Bauweise angebrachte Halbleitermaterialien anzuregen, und auch für Vibrations-Harvester, die auf resonante Frequenzen getunt sein müssen, um effektiv zu arbeiten.
Für 2015 erwartet Gartner, dass RF Energy Harvesting auf dem Radarschirm industrieller Anwender auftaucht. Befürworter dieser Technologie argumentieren damit, dass wir mit WiFi, Zigbee, Bluetooth und anderen Technologien, die uns umgeben, bereits in einem Meer aus Radiowellen schwimmen. Und eine Menge davon sollte sich einsammeln lassen. Letztlich müsste man aber auch hier mit einem großen Generator starten: Die generierte Energie würde an einen Empfänger übertragen und die dort empfangene Energie in eine gebrauchsfähige Spannung umgewandelt. Je stärker der RF-Strahl, umso mehr Energie ließe sich einsammeln.
Bisher sieht es so aus, als ob immer etwas mehr Energie in die »Maschine« gegeben werden müsste, als am Empfänger zu ernten ist. Das Konzept des RF-Energy-Harvesting mag ein wenig wie der Jahrhunderte alte Traum vom Perpetuum Mobile erscheinen, doch man darf gespannt sein, wie sich dieser Technologieansatz in den nächsten Jahren entwickelt.
Die Kosten eingebauter Spulen und Empfänger für schnurloses Laden mögen bislang bei Handy-Herstellern jenseits von Nokia und LG noch nicht für marktfähig gehalten werden, aber die Hersteller von Wearable Electronics sehen in der schnurlosen Ladung eine entscheidende Möglichkeit, den Formfaktor ihrer Produkte zu verkleinern und vom ärgerlichen Mikro-USB-Steckverbinder wegzukommen. Gleichzeitig würde das die Möglichkeit bieten, das Gehäuse abdichten zu können, wenn sich Wasserdichtigkeit als wichtiges Entscheidungskriterium für den Kauf von Wearable Electronics herausstellen sollte. Qualcomm zum Beispiel nutzt eine Variation der A4WP-Resonance-Technologie, um seine Toq Smart Watch schnurlos zu laden. Es wird interessant sein zu sehen, wie Apple das Problem der schnurlosen Ladung bei seiner für dieses Jahr angekündigten iWatch gelöst hat.
Energy Harvesting wird dort am dringendsten benötigt werden, wo schnurlose Sensorknoten an Stellen im Internet of Things zum Einsatz kommen, die sich deutlich von bisherigen Anwendungen im Elektronikbereich unterscheiden. Harvester bieten sich überall dort an, wo der Wechsel einer Batterie kompliziert und aufwändig wäre. Zwar bietet eine Knopfzelle eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren, aber es gibt eben noch eine ganze Reihe anderer Energiequellen, die sich zur Versorgung nutzen lassen, wie etwa Vibration, Bewegung oder Temperaturunterschiede. Unglücklicherweise befindet sich die Entwicklung von Energy-Harvesting-Lösungen immer noch in den Kinderschuhen, und es dürften nach Einschätzung von Gartner noch fünf bis zehn Jahre Entwicklung nötig sein, bis diese Technologie Mainstream-fähig ist. Das Problem der aktuellen Energy-Harvester besteht vor allem darin, dass sie eine relativ große Oberfläche benötigen, um zumindest ein minimales Maß an Energie zu erzeugen (20 mW). Dies gilt für Ambient-Light-Harvesting, wo auf Raumbeleuchtung ausgerichtete Solarzellen eingesetzt werden, und für Thermal-Energy-Generatoren, die versuchen, zwischen heißen und kalten Oberflächen in Sandwich-Bauweise angebrachte Halbleitermaterialien anzuregen, und auch für Vibrations-Harvester, die auf resonante Frequenzen getunt sein müssen, um effektiv zu arbeiten.
Für 2015 erwartet Gartner, dass RF Energy Harvesting auf dem Radarschirm industrieller Anwender auftaucht. Befürworter dieser Technologie argumentieren damit, dass wir mit WiFi, Zigbee, Bluetooth und anderen Technologien, die uns umgeben, bereits in einem Meer aus Radiowellen schwimmen. Und eine Menge davon sollte sich einsammeln lassen. Letztlich müsste man aber auch hier mit einem großen Generator starten: Die generierte Energie würde an einen Empfänger übertragen und die dort empfangene Energie in eine gebrauchsfähige Spannung umgewandelt. Je stärker der RF-Strahl, umso mehr Energie ließe sich einsammeln.
Bisher sieht es so aus, als ob immer etwas mehr Energie in die »Maschine« gegeben werden müsste, als am Empfänger zu ernten ist. Das Konzept des RF-Energy-Harvesting mag ein wenig wie der Jahrhunderte alte Traum vom Perpetuum Mobile erscheinen, doch man darf gespannt sein, wie sich dieser Technologieansatz in den nächsten Jahren entwickelt. (eg)
Jobangebote+ passend zum Thema
- GaN wird erst in fünf Jahren wirklich marktrevant
- Schnurloses Laden liegt im Trend