Erfolgreiche Embedded-Massenspeicher
Die entscheidenden Details des SSD
Fortsetzung des Artikels von Teil 2
Neue Technologien von Flash-Herstellern
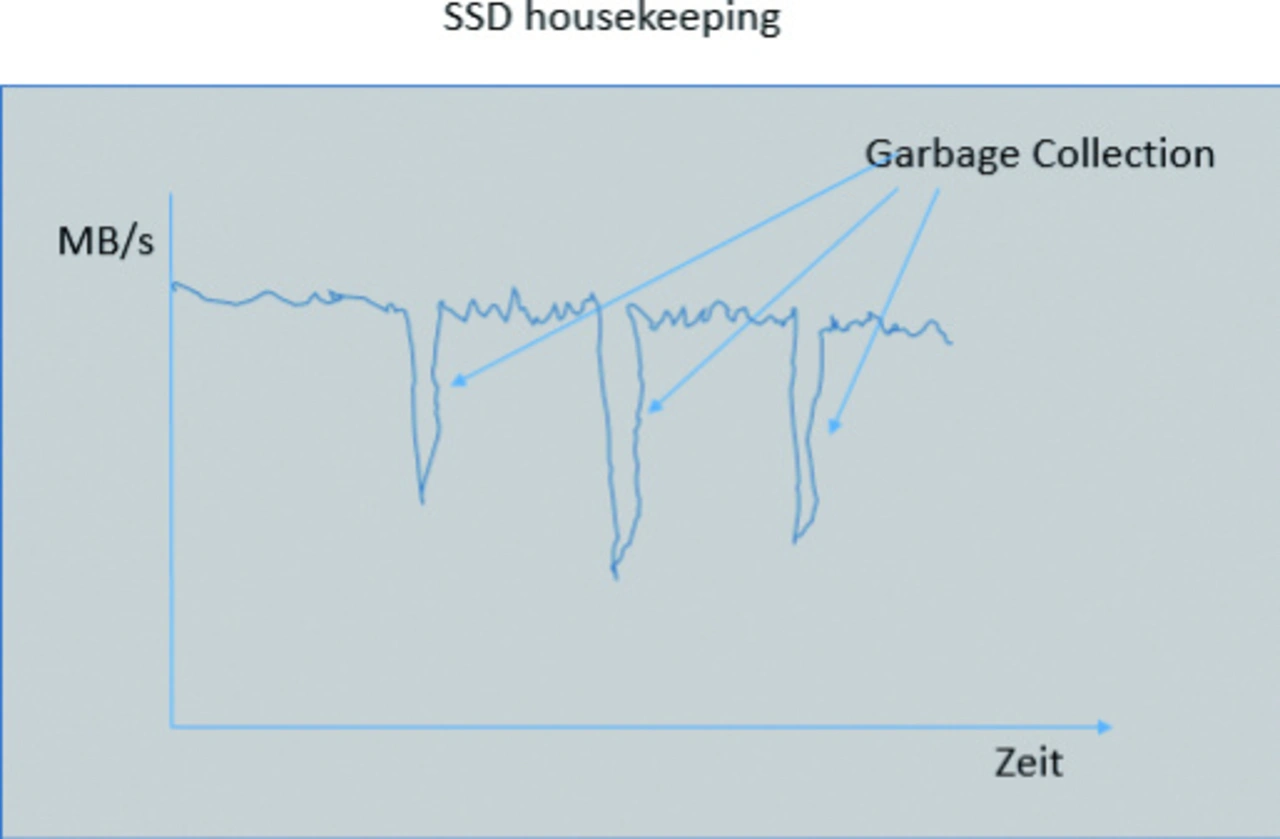
SSDs werden heute standardmäßig in 2,5-Zoll-Gehäusen geliefert und finden überall dort Einsatz, wo entweder ein HDD schon zuvor verwendet wurde oder man einfach auf diesen flexiblen, leicht austauschbaren Formfaktor gehen möchte, da die 2,5-Zoll-SSDs Hot-Swap-fähig sind. Den Formfaktor M.2 gibt es in verschiedenen Ausführungen, wobei die vierstellige Zahl die Breite und die Länge angibt. Favorisiert wird derzeit der Formfaktor 2280 mit 22 mm Breite und 80 mm Länge. Daneben gibt es 2230, 2242, 2260 und aktuell für die größeren Kapazitäten ab 4 TB kommt 22110. M.2 mit 2280 und 2242 werden in großen Stückzahlen produziert und eingesetzt. M.2 ist nicht Hot-Swap-fähig.
Der Formfaktor 2,5 Zoll wird auch noch in zukünftigen Anwendungen eingesetzt werden. Anders sieht es beim mSATA aus, der mit Verzögerung vom Markt aufgenommen wurde und für neue Entwicklung ganz klar in Richtung M.2 geht.
Das Interface ist die logische und elektrische Schnittstelle zwischen der SSD und der CPU. Die Schnittstelle definiert die maximale Bandbreite, die minimale Latenz, die Erweiterbarkeit und Hot-Swap-Fähigkeit. Es gibt drei grundlegende Schnittstellenoptionen:
SATA wird heute standardmäßig in fast allen Systemen verwendet, stößt aber, wenn es um eine bessere Performance oder höhere Kapazitäten geht, an Grenzen. Hier wird dann SAS eingesetzt. Sind hohe Geschwindigkeiten gefordert, kommt NVMe ins Spiel. NVMe basiert auf PCI Express und wird in Servern eingesetzt. Mit den neueren Boards kommt dieses Interface immer mehr in der Industrie oder im Gaming-Bereich zur Anwendung.
Das Protokoll NVMe ist der Nachfolger von AHCI. Bislang weisen SSDs Geschwindigkeiten von rund 500 MB/s auf. Im Vergleich dazu sind SSDs mit NVMe um einen Faktor 2 bis 3 schneller, da sie direkt über PCIe angeschlossen sind und so der Flaschenhals von SATA/SAS umgangen wird. Bei den NVMe-SSDs gibt es zwei Versionen: Gen3-x2 und Gen3-x4. Dies steht für Generation 3 und entweder zwei oder vier Lanes. Bei zwei Lanes beträgt die Lesegeschwindigkeit theoretisch maximal 2 GB/s und bei vier Lanes maximal 4 GB/s.
Mit dem Übergang von 2D-NAND- auf 3D-NAND-Flash produzieren die Hersteller immer größere SSDs und Flash-Karten und machen dem HDD extrem Konkurrenz. Reicht in der Applikation beispielsweise 16 GB oder 32 GB Kapazität des SSD aus, dann findet man diese nur noch bei den Third-Party-Herstellern, aber nicht mehr bei den großen Flash-Drive-Herstellern. Neuere SSD-Generationen gehen erst ab einer Kapazität von 256 GB los. Diese aber dann zu einem Preis, der in der Nähe zu vorherigen 128 GB liegt. Damit bekommt der Anwender fast zum gleichen Preis die doppelte Kapazität.
War im Jahre 2018 bei den SSDs die 3D-NAND-Bestückung hauptsächlich mit 64-Layer-Flash, wird 2019 die Fertigung von Produkten mit 96 Layern nach oben gefahren. Ebenso werden SSDs, die mit 3D-QLC-Flash bestückt sind, ausgeliefert. Das SSD wird zusätzlich neue Bereiche erobern, sei es im 2,5-Zoll- oder M.2-Format, als Flash-Karte oder als eMMC oder UFS. Beim Interface steht eine Ablösung von SATA und SAS in Richtung NVMe bevor.
Die Flash-Hersteller entwickeln natürlich schon die nächsten Technologien wie PCM (Phase Change Memory), ReRAM (Resistive RAM) und MRAM/SST. Zudem sollen die neuen SCMs (Storage-Class-Memory) die Lücke zwischen einem schnellen DRAM und einem nichtflüchtigen Flash schließen: DRAM ist zwar schnell, hält aber nach Wegfall der Versorgungsspannung die Daten nicht; Flash ist nichtflüchtig, aber dafür langsam. Es bleibt spannend, welche Technologie sich auf dem Massenmarkt durchsetzt.
Jobangebote+ passend zum Thema
- Die entscheidenden Details des SSD
- Lebensdauer eines SSD
- Neue Technologien von Flash-Herstellern