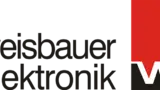Leistungselektronik
Neue Aufbautechnik für das Hybrid-Fahrvergnügen
Fortsetzung des Artikels von Teil 1
Halbleiterleistungsmodule aus dem Kostenblickwinkel betrachtet
Einen wesentlichen Anteil an den Herstellkosten eines Hybridantriebs hat die Leistungselektronik. Neben Hochvoltbatterie und Elektromotor zählt sie zu den wertbestimmenden Komponenten. Innerhalb der Leistungselektronik spielt das Halbleiterleistungsmodul hier eine Hauptrolle.
Diese Module ermöglichen durch hochpulsiges Schalten die verlustarme Umformung von Gleich- in Wechselspannung und stellen die Leistungsendstufe des fahrzeugeigenen Frequenzumrichters dar. Was bei stationären Umrichtern zuverlässig und über Jahre funktioniert, muss jedoch für den Automobileinsatz besonders angepasst werden.
Betriebsprofile und Temperaturen unter der Motorhaube sind anspruchsvoll und lassen die Bauelemente schneller altern als in einem klimatisierten Schaltschrank. Vor allem die Anfahr- und Bremsvorgänge im Stadtverkehr sowie das Starten und Anhalten des Verbrennungsmotors fordern von den Leistungstransistoren viele kurzzeitige Stromspitzen. Die damit einhergehenden Temperaturwechsel belasten vor allem Bonddrähte und jegliche Fügestellen, an denen Materialien mit unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten aufeinandertreffen.
Die hier auftretenden Ermüdungs- und Schädigungsmechanismen in Aufbauten von Leistungshalbleitern sind schon lange bekannt. In herkömmlichen Aufbauten wurde ihnen mit klassischen Maßnahmen begegnet:
Zunächst sorgen eine souveräne Überdimensionierung der Halbleiterflächen, die intensive Kühlung mit einem gesonderten Kühlkreislauf und zusätzliche redundante Bonddrähte für weniger thermomechanischen Stress. Hierdurch lässt sich dem vorzeitigen Ausfall vorbeugen. Das geschieht allerdings um den Preis größeren Materialaufwands, höherer Kosten und eines vermehrten Platzbedarfes.
Als kritische Elemente in der herkömmlichen Aufbautechnik gelten Aluminium-Dickdraht-Bondverbindungen und traditionelle Lotschichten, um die Halbleiter auf Substraten oder aber die Substrate auf Bodenplatten und Kühlkörper anzubinden.

Durch Ultraschallenergie werden Aluminiumdrähte zur Kontaktierung auf Silizium-Halbleitern gebondet. Hohe Unterschiede in der thermischen Ausdehnung beider Materialien führen jedoch zu einer sukzessiven Ermüdung der Bondstelle. Das geschieht umso schneller, je höher Temperatur und Lastwechsel darauf einwirken. Nachdem sich ein erster Bonddraht vom Leistungshalbleiter abgelöst hat, müssen die verbleibenden Drähte den gesamten Strom tragen. Damit schreitet die Schädigung beschleunigt bis zum Ausfall des Moduls fort (Bild 1).
Bei Lötverbindungen, wie sie zur Verbindung von Halbleitern und keramischen Schaltungsträgern zum Einsatz kommen, lässt sich ebenfalls eine temperaturabhängige Alterung feststellen. Die heute verwendeten bleifreien Weichlote werden in anspruchsvollen Anwendungen immer dichter an der Grenze ihrer Schmelztemperatur betrieben. Dabei gilt: Gerade ein Lot, das noch nicht aufgeschmolzen ist, degradiert umso schneller, je höher die Temperatur ist. Die bisher akzeptierte Alternative hoch bleihaltiger Lote soll künftig nicht mehr in automobilen Anwendungen zum Einsatz kommen.
- Neue Aufbautechnik für das Hybrid-Fahrvergnügen
- Halbleiterleistungsmodule aus dem Kostenblickwinkel betrachtet
- Neue Aufbau- und Verbindungstechnik
- Im Fokus: Bond-Buffer-Technologie
- Entwärmung von Leistungshalbleitern
- Literaturangaben
- Die Autoren:
- Die Autoren