Industrielle PC-Boards
»Es gibt gute Gründe, nicht alles in der Cloud zu machen«
Fortsetzung des Artikels von Teil 1
»Bei den Produkten braucht sich AMD nicht verstecken«
Elektronik: AMD ist mit dem Ryzen-Prozessor ein Comeback gelungen, allerdings im Bereich der Hochleistungs- und Gaming-Anwendungen. Sind von AMD auch noch Neuheiten im Embedded-Bereich zu erwarten oder ist AMD den Embedded-Kunden generell ein zu unsicherer Lieferant?
Peter Hoser: Ganz und gar nicht. Für uns war AMD schon immer wichtig, vor allem, wenn es um Low-Power-Plattformen geht. Hier ist AMD mit seiner G-Series neben Intel Atom so erfolgreich, dass wir uns entschieden haben, den Support für G-Series noch einmal um fünf Jahre, also bis Ende 2022, zu verlängern. Das Lifecycle-Management bei AMD funktioniert hervorragend und die Leistung reicht bei weitem aus. Gerade im Gaming-Bereich haben wir hier viele Kunden. Nicht zu vergessen, dass AMDs G-Series neben Windows 10 auch noch Windows 7 und sogar XP unterstützt. Der Umstieg auf Windows 10 bereitet vielen Industriekunden doch noch einige Probleme und einen enormen Aufwand.
Im Industriebereich tun sich viele Kunden allerdings immer noch schwer mit AMD. Bei den Produkten braucht sich AMD nicht verstecken, aber Industriekunden fühlen sich – nicht zuletzt aufgrund des Images – mit Intel eben immer auf der sicheren Seite. Das ist meines Erachtens ein psychologischer Aspekt: Wenn ich mit Intel-Geräten ein Problem habe, dann bin ich als Einkäufer dennoch auf der sicheren Seite, da ich vom Marktführer gekauft habe. Wenn es mit AMD-Komponenten Schwierigkeiten gibt, dann muss ich mich als Einkäufer stärker rechtfertigen
Jobangebote+ passend zum Thema

Dieter Baumann: Es gab ja auch mal Zeiten, in denen AMD nicht so gut dastand und in der Kunden, die langfristig planten, sich gefragt haben, ob AMD als Lieferant langfristig am Markt bestehen kann. Dieses Bild hat sich zuletzt stark gewandelt.
Elektronik: Intel hat sein Tic-Toc-Modell um einen weiteren Optimierungsschritt zu einem dreistufigen Zyklus ausgeweitet. Machen Sie nach wie vor jede Prozessorgeneration mit, d.h. entwickeln sie jedes Mal eine neue Generation von Systemboards?
Peter Hoser: Ja, im Desktop-Bereich müssen wir das machen. Das liegt auch daran, dass Intel den Markt über die CPU-Preise diktiert. Gerade im Bereich der Kaby-Lake-Prozessoren gab es einige attraktive Modelle.
Wenn der Kunde diese haben möchte und wir sie nicht anbieten könnten, wäre das ausgesprochen schlecht. Im Industriebereich haben wir versucht, diese Zyklen etwas zu „entschleunigen“, indem wir nur alle zwei Jahre eine neue Plattform mit neuen Designs anbieten. Aber es ist im Moment nicht klar, ob wir das mit dem neuen „Tic-Toc-Toc“-Zyklus so weiterführen können.
Unsere aktuelle Familie an Industrie-Mainboards (mini-ITX, µATX und ATX) ist eine Skylake-Plattform (6. Gen.), die Kaby-Lake-ready ist (7. Gen.) – also sehr aktuell. Mit der nächsten Generation, Coffee Lake (8. Gen.), werden wir wieder eine komplette Familie an Industrie-Mainboards mit neuen Designs anbieten. Ob wir dann die 9. Generation wieder auslassen werden, ist fraglich. Denn die ist wieder ein „Tic“, also eine neue Prozessgeometrie, und da müssen wir sehen, wie revolutionär das ausfallen wird und ob sich der Wechsel für unsere Kunden lohnt.
Elektronik: Die Innovationsspirale bei den Prozessoren hat sich deutlich entschleunigt. Wäre es da nicht konsequent, wenn Sie den „Extended Lifecycle“ ihrer Mainboard verlängern?
Peter Hoser: Unsere Industrieboards sind sechs Jahre lieferbar und das hat sich als idealer Zeitraum für Industriekunden erwiesen. Es gibt sicher einige Produkte, die längere Lebenszyklen bräuchten, wie z. B. eine Triebkopfsteuerung im ICE, aber dort werden dann meistens Modullösungen eingesetzt. Ihre Frage kommt ja wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, dass Intel seine ganzen Embedded-Produkte jetzt plötzlich 15 Jahre lang anbietet – dabei sollte man aber immer bedenken, dass sich auf einem Board ja auch noch eine Vielzahl anderer Komponenten befindet.
Dieter Baumann: Intel möchte in neue Märkte wie z. B. die Automotive-Industrie. Diese Märkte erfordern, dass Produkte so lange lieferbar sind. Das dürfte der Hintergrund für diese Ankündigung sein.
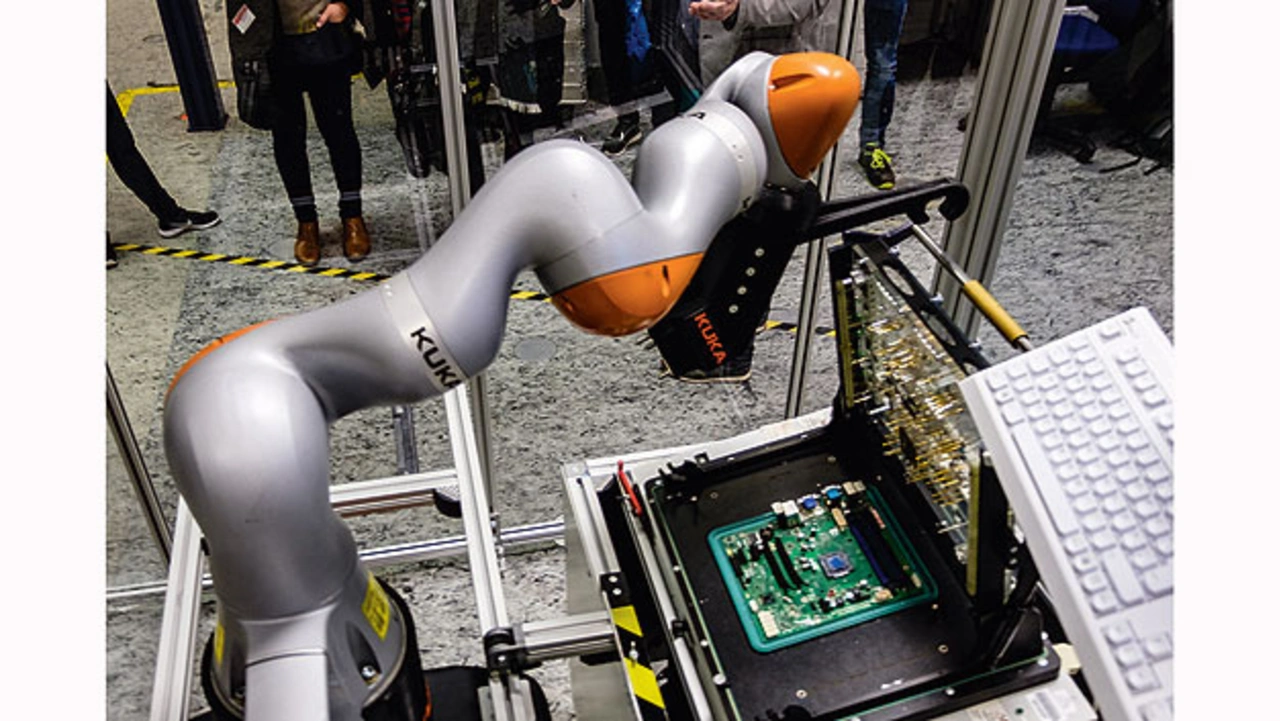
Elektronik: Woran scheitert es mit dem Zyklus von 15 Jahren?
Peter Hoser: In 15 Jahren kommen zehn bis 15 neue Plattformen zusammen und die bringen jeweils neue Standardkomponenten mit. Für Intel mag das angekündigte Modell profitabel sein, die anderen Bauteilehersteller haben jedoch sinkende Volumen und kündigen ihre Bausteine ab. Warum sollten sie die Chips weiter produzieren, damit ein Kunde in ein paar Jahren einige wenige davon kauft? Wer möchte denn heute noch ein USB-1.1-Interface oder eine 10-Mbit-Ethernet-Schnittstelle haben?
Dieter Baumann: Der Markt ist so getaktet, dass die Hersteller jedes Jahr etwas Neues herausbringen. Nach zwei, drei Jahren ist das Volumen dann erschöpft und geht zurück. Dann ein Produkt 15 Jahre lang zu liefern, geht nicht zu den gleichen Kosten. Wer das will, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen.
Peter Hoser: Selbst die Ethernet-Controller von Intel haben keine 15 Jahre Verfügbarkeit. Wir haben in unserem Lifecycle-Management ein Radarsystem: Wenn kritische Komponenten abgekündigt werden, dann müssen wir entscheiden, ob wir ein Redesign machen – was unsere Kunden i.d.R. nicht wollen, weil es mit zusätzlichen Kosten verbunden ist – oder eine Resteindeckung durchführen. Dafür haben wir spezielle Lagerschränke für elektronische Bauteile. So können wir zuverlässig sieben Jahre Lebenszeit managen.
Elektronik: Warum kann man die Komponenten nicht länger einlagern?
Peter Hoser: Durch die Lagerung an der Luft dringt mit der Zeit Feuchtigkeit ins Gehäuse der Bauteile ein. Wenn so eine Komponente dann im Lötofen auf über 240 Grad erhitzt wird, wird sie buchstäblich gekocht und das Bauteil platzt auf. Man spricht dabei von einem sogenannten Popcorn-Effekt. Also müssen die Komponenten vor dem Löten vorbehandelt – getrocknet – werden, sonst hat man am Ende eine Ausbeute von unter 70 Prozent. Fertig gelötete und produzierte Boards lassen sich häufig viel sinnvoller und sicherer aufbewahren. Deshalb ist es oft ratsam, Komponenten nur eine begrenzte Zeit ein¬zulagern und dann die Produkte fertig zu produzieren. Damit vermeidet man unvorhergesehene und nicht kalkulierbare Probleme beim Löten. Zwar ist das mit höherem Aufwand verbunden, aber auf einem Mainboard sind über 1.500 Komponenten verbaut. Wenn nur eine davon nicht mehr lötbar ist, kann man das gesamte Produktionslos nicht mehr verwenden.
Elektronik: Bei Embedded-Anwendern sind die Mini-Formfaktoren wie z. B. NUC sehr beliebt. Bei Fujitsu aber anscheinend nicht…
Peter Hoser: Das industrielle Umfeld ist sehr vielfältig. Deshalb machen auch die Formfaktoren, die wir anbieten, nach wie vor Sinn. Ich bin selbst erstaunt, dass das ATX-Format bei uns immer noch das stärkste Volumen ausmacht. Die Kunden installieren dort alle möglichen Erweiterungskarten: CAN-Bus-Karten, Framegrabber-Karten – die haben alle ihre Berechtigung.
Die Miniaturisierung wird vorangetrieben, weil es immer mehr neue Anwendungen gibt: zum Beispiel Kiosk, Point-of-Sales, Ticketing. Da hat Intel mit NUC einen Trend gesetzt. Ob es jedoch für alle Fälle das richtige Format ist, bezweifle ich, denn NUC ist zu klein, um ihn in vielen Szenarien ausreichend kühlen zu können und zu klein, um genügend Connectivity für viele Anwendungsbereiche zu haben. Wir haben uns deshalb für Mini STX entschieden. Das Format ist mit 14 mal 14,7 cm2 recht kompakt und hat an den Kanten genügend Platz für die Steckverbinder.
Elektronik: Sind schon Auswirkungen absehbar, die das Joint-Venture mit Lenovo auf die Fujitsu-Fabrik in Augsburg haben wird?
Dieter Baumann: Das Joint Venture betrifft nur die FCCL, die Fujitsu Client Computing Ltd. Das ist der Client-Computing-Bereich von Fujitsu. Nur dieser geht in das Joint-Venture ein. Andere Bereiche wie Mainboards, Server und Storage sind davon ausgenommen. Auch unser Werk in Augsburg ist nicht Bestandteil des Joint Ventures und bleibt vollständig im Besitz von Fujitsu.
Dieter Baumann
Head of Hardware & FW Development, Client Computing Devices Engineering. Diese Abteilung entwickelt Mainboards inklusive BIOS/Firmware und Add-on-Boards für PCs, Thin Clients, Workstations, Industrial- und Server-Systeme von Fujitsu. Baumann studierte Elek-trotechnik mit Schwerpunkt Nachrichtentechnik an der FH Augsburg.
Peter Hoser
Director OEM Sales, Systemboard. Während des Joint-Ventures von Siemens und Fujitsu und später der Übernahme des Werks durch Fujitsu baute der studierte Maschinenbau-Ingenieur das Geschäft mit externen Systemboard-Kunden auf. Damit trug er wesentlich zur Sicherung des Standorts bei. Inzwischen produziert das Werk u.a. zwei Millionen Mainboards pro Jahr und beschäftigt 400 bis 450 Mitarbeiter.
- »Es gibt gute Gründe, nicht alles in der Cloud zu machen«
- »Bei den Produkten braucht sich AMD nicht verstecken«