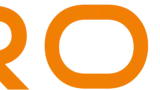IEC-Meeting
Normung für Industrie 4.0
Fortsetzung des Artikels von Teil 1
Die Industrie braucht Beständigkeit
Zwar könnte man XML als Beschreibungssprache nehmen – das Problem ist aber, dass XML „extensible“ ist. Eine Sprache, die ständig verändert und erweitert wird, kann die Investitionsgüterindustrie jedoch nicht brauchen. Geräte in großen Anlagen laufen 15 Jahre und länger, und auch dann soll die Sprache noch gültig sein. Die TC65 strebt einen Standard wie ecl@ss für die eindeutige Beschreibung von Eigenschaften an, braucht aber zusätzlich noch so etwas wie EDDL, womit sich Konfigurationen beschreiben lassen. Konfiguration bedeutet: Die Eigenschaften des Geräts ändern sich während des Betriebs, etwa indem ein Meßumformer kalibriert wird.
Wie wahrscheinlich aber ist es, dass sich alle Beteiligten auf eine gemeinsame Sprache einigen? – Das sieht Roland Heidel ganz realistisch: „Wenn es einen gibt, der voran marschiert, dann gibt es immer auch Nachahmer, die dasselbe machen, aber anders.“ Er erinnert an den Feldbus-Krieg und die Interkama 1989. „Damals gab es 30 verschiedene Feldbusse. Heute hat sich das durch den Markt auf drei wichtige reduziert“.
Wer macht den Standard?
Industrie 4.0 ist gekennzeichnet durch das Zusammenwachsen von IT, Automatisierung und Telekommunikation. Dementsprechend versuchen auch die Protagonisten aus IT und Telekommunikation, ihre Standardisierungsvorstellungen durchzusetzen.
So hat sich jüngst in den USA ein „Industrial Internet Consortium“ gegründet. Initiatoren sind überwiegend IT-Firmen wie Cisco, IBM, Intel und GE. Sie wollen „die Anforderungen identifizieren, um nahtlos intelligente Geräte, Maschinen, Menschen, Prozesse und Daten miteinander zu verbinden“. Auch die Telekommunikationsbranche hat das Internet der Dinge längst entdeckt. Hier entfaltet das ETSI (European Telecommunications Standards Institute) als europäisches Pendant der ITU (International Telecommunication Union) bereits Aktivitäten, die den Automatisierern Sorgen machen. ETSI hat die hoheitliche Aufgabe, alles, was mit Funk zu tun hat, für die EU zu regeln. Neben 24 drahtgebundenen Protokollen wird auch die drahtlose Kommunikation in der Industrie in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, etwa bei Anwendungen wie Car2Car, Smart Meter oder Gütern, die sich mobil durch Produktionshallen bewegen. Diese industriellen Anwendungen brauchen Kommunikationsmechanismen, die z.B. innerhalb gewisser Zeitschranken reagieren. ETSI setzt sich aber nicht mit den Anforderungen der Automatisierungsindustrie auseinander. Gleichzeitig gelten die von ETSI erlassenen Vorschriften für alle Geräte, die in der EU betrieben werden. Und da sind Vorschriften in Vorbereitung, die für die Nutzung des ISM-Bandes (Industrial, Scientifical, Medical) einen „Listen before Talk“-Modus vorsehen. ETSI befürchtet, dass das ISM-Band durch zu viele Teilnehmer überlastet werden könnte. Deshalb soll eine Vorschrift erlassen werden, dass Teilnehmer nur noch senden dürfen, wenn „Funkstille“ herrscht.
Wenn Welten aufeinander treffen
Der VDE hält das für eine Überregulierung. Ingo Rolle, der sich beim VDE mit Fragen der Standardisierung auseinandersetzt, sagt: „Erstens sind wir von einer Überlastung des ISM-Bands noch weit entfernt, zweitens hat die Ethernet-Standardisierung gezeigt, wie ein solcher Mechanismus zur Kollisionsvermeidung ein Medium unbenutzbar machen kann.“ Der VDE hat Alternativen vorgeschlagen, die aber vom ETSI nicht aufgegriffen wurden. Unter anderem würde sich der VDE eine Regelung wünschen, die die Koexistenz verschiedener Regelungen durch Entfernung ermöglicht. Nach derzeitiger Gesetzeslage müssen aber alle Geräte die gleichen Zugangsvoraussetzungen zum Funknetz erfüllen – auch wenn sie sich auf einem abgeschirmten Fabrikgelände befinden.Der Fall ist ein typisches Beispiel dafür, was passiert, wenn Automatisierung, IT und Telekommunikation aufeinandertreffen.
TC65-Chairman Roland Heidel lenkt den Blick auf das, was mittelfristig erreichbar ist: „In etwa zwei bis drei Jahren werden wir so weit sein, dass ein Standard für die Selbstauskunft von Geräten und Diensten so weit beschrieben ist, dass er von allen akzeptiert wird.“ Dann kommt es darauf an, dass ein solcher Standard in Produkte umgesetzt wird. Aber was passiert mit den anderen Standards? – Heidel: „Ich könnte mir vorstellen, dass es das Internet der Dinge in verschiedenen Ausprägungen geben wird, ein IoT für Industrie 4.0, eines für Smart Grid, für Connected Cars etc.“ Schon heute gäbe es ja verschiedene Dienste und nicht das Internet. Sein Fazit: „Das Internet lässt sich nicht standardisieren. Und bis zum Maximalfall, dass ein Produkt weiß, wie es produziert wird, kann es noch Jahre dauern. Aber was wir bald haben werden, sind bestimmte vorgefertigte Prozesse, die sich selbst organisieren und koordinieren können.“
- Normung für Industrie 4.0
- Die Industrie braucht Beständigkeit