Von Verkäufern und Neandertalern
Warum wir nicht gerne verkaufen
Fortsetzung des Artikels von Teil 1
Verkaufen heißt Führen
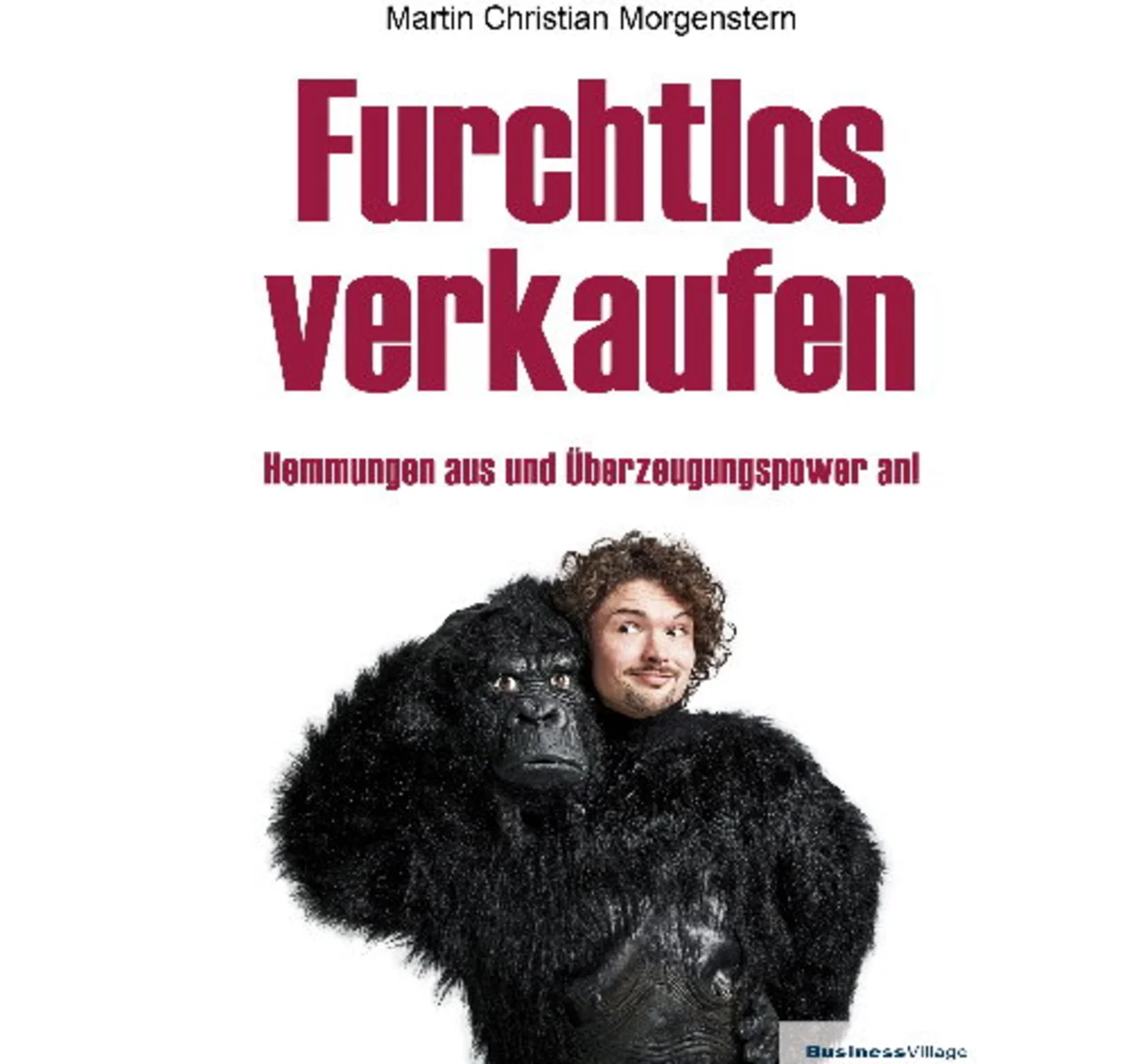
Morgenstern überträgt den Mechanismen „Führung“ und „Ich möchte mich mit anderen gut verstehen“ auf den Verkauf. Bei Kundenakquise und im späteren Verkaufsgespräch muss ein anderer Mensch gewonnen und zu einer Sache hingeführt werden. Dabei entsteht nun für den Verkäufer ein deutliches Risiko, vom potentiellen Kunden abgelehnt zu werden.
Diese Ablehnung interpretiert das auf soziale Steinzeit programmierte Gehirn in ein „der andere mag mich nicht“ und „wenn ich jetzt stark auf Führung gehen würde, riskiere ich einen Machtkampf.“ Diese beiden sozialen Ängste sind in der Steinzeit auch durchaus berechtigt. Heute stehen sie uns allerdings in vielen Bereichen im Weg. Für den Verkauf bedeutet das zum Beispiel, das viele Menschen diese Jobs meiden oder nach kurzer Zeit abbrechen, obwohl es dort ohne Ängste durchaus Spaß machen könnte und darüber hinaus auch noch meist gut bezahlt ist.
Deswegen würde es Sinn machen, findet Morgenstern, wenn alle Verkäufer zum Beginn ihrer Karriere nicht nur in Verkaufs- und Kommunikationstechniken geschult würden. Sondern auch darin, wie man natürliche Ängste und Hemmungen schnell überwindet und durch positive Erfahrungen ersetzt.
Die Mechanik der Angst
Die Angststeuerung findet in einem nicht dem bewussten Willen unterliegenden Bereich des Gehirns statt. Dort wird innerhalb von Sekunden Bruchteilen eine Angstreaktion gestartet, ohne dass jemand darauf bewusst Einfluss nehmen kann. Ob und wann sie gestartet wird, hängt insbesondere von dem Erfahrungsschatz eines Menschen ab.
Im Verkauf werden nahezu automatisch soziale Schutzmechanismen mit hemmender Angst aktiviert. Präsentationen und Vorträge vor fremden Menschen lösen im Übrigen ein ähnliches Szenario aus. Um Ängste und Hemmungen zu verlieren, muss das Gehirn deshalb erst einmal einige positive Erfahrungen sammeln, um sich der, in der Regel nicht gegebenen, Gefahr klar zu werden. Wohl bemerkt aber findet dieser Vorgang auf einer nichtbewussten Ebene statt. Das bedeutet, das reine Wissen, dass Verkaufssituationen nicht gefährlich sind, reicht nicht aus um das Auslösen einer Angstreaktion zu verhindern. »Nur Erfahrungen können dies ersetzen«, weiß Morgenstern.
Ängste zu verlieren, heißt deshalb genau das zu tun, wo das Gefühl der Angst sagt: „Auf keinen Fall!“ Um überhaupt gegen das eigene Gefühl handeln zu können, müssen Ängste erst einmal akzeptiert werden. Denn wer von sich selber überzeugt ist, keine Ängste zu haben, möchte ungern mit diesem Punkt konfrontiert werden.
Deshalb wird er in der Regel die Angst auslösenden Situationen vermeiden. Er würde sich aber, um die Vorstellung von sich selber, nämlich keine Angst zu haben, stabil zu halten, jetzt Erklärungen für die Vermeidung finden. Diese Erklärungen werden sich dann auf real greifbare Dinge wie „der Kunde hat eh kein Interesse an diesem Produkt "oder „ jetzt ist der falsche Zeitpunkt zur Kontaktaufnahme“ beziehen.
Morgenstern: »Das spannende an diesen Erklärungen ist, dass der Betreffende in diesem Moment auch wirklich daran glaubt, dass dies die Wahrheit für sein Verhalten ist.« Die Ursache dafür liege in der modularen Arbeitsweise des Gehirns. Die für die emotionale Steuerung zuständigen Gehirnareale übersetzen den für die Erklärung zuständigen Gehirnarealen nicht immer, warum sie eine bestimmte emotionale Reaktion gestartet haben.
Menschen aber möchten für alle Verhaltensweisen eine Erklärung haben. So kommt es, dass der bewusste Bereich des Gehirns immer wieder versucht, Erklärungen für die Entscheidungen des emotionalen Gehirns zu finden. Um mit Ängsten arbeiten zu können ist es deswegen so wichtig, die eigene Angstreaktion als archaisches Schutzinstrument zu akzeptieren. » Die Akzeptanz bildet die Grundlage, um entgegen dem Angstgefühl trotzdem handeln und so Erfahrungen machen zu können. Diese Erfahrungen wiederum dienen dann dazu, dem Gehirn die Sicherheit zu geben, um eine Schutzreaktion nicht mehr zu brauchen.«
Jobangebote+ passend zum Thema
- Warum wir nicht gerne verkaufen
- Verkaufen heißt Führen
- Erfahrung ersetzt Angst