Neues Halbleitermaterial
AlYN für energieeffizientere und leistungsfähigere Elektronik
Mit Aluminiumyttriumnitrid (AlYN) ist es Forschern des Fraunhofer-Instituts IAF im Sommer gelungen, ein neues, vielversprechendes Halbleitermaterial mit dem MOCVD-Verfahren herzustellen und zu charakterisieren.
Aluminiumyttriumnitrid hatte aufgrund seiner hervorragenden Materialeigenschaften bereits in der Vergangenheit das Interesse verschiedener Forschungsgruppen geweckt. Jedoch stellte das Wachstum des Materials bislang eine große Herausforderung dar. So gelang es bislang nur, AIYN mit dem Magnetron-Sputter-Verfahren abzuscheiden. Forschenden des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Festkörperphysik IAF ist es nun vor Kurzem gelungen, das neue Material mithilfe der MOCVD-Technologie (metallorganische chemische Gasphasenabscheidung) herzustellen und damit die Erschließung neuer, vielfältiger Anwendungen zu ermöglichen.
»Unsere Forschung markiert einen Meilenstein in der Entwicklung neuer Halbleiterstrukturen. AlYN ist ein Material, das eine Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Minimierung des Energieverbrauchs ermöglicht und damit den Weg für Innovationen in der Elektronik ebenen kann, die unsere digital vernetzte Gesellschaft und die stetig steigenden Anforderungen an Technologien dringend benötigen«, so Dr. Stefano Leone, Wissenschaftler am Fraunhofer IAF im Bereich Epitaxie. Aufgrund seiner vielversprechenden Materialeigenschaften kann AlYN zu einem Schlüsselmaterial für zukünftige technologische Innovationen werden.
Jüngste Forschungen hatten bereits die Materialeigenschaften von AlYN wie Ferroelektrizität nachgewiesen. Bei der Entwicklung des neuen Verbindungshalbleiters konzentrierten sich die Forschenden am Fraunhofer IAF vor allem auf dessen Anpassungsfähigkeit an Galliumnitrid (GaN). So lässt sich die Gitterstruktur von AIYN optimal an GaN anpassen und die AlYN/GaN-Heterostruktur verspricht wesentliche Vorteile für die Entwicklung zukunftsweisender Elektronik.
Von der Schicht zur Heterostruktur
Bereits im letzten Jahr hatte die Forschungsgruppe am Fraunhofer IAF bahnbrechende Ergebnisse erzielt, als es ihnen erstmals gelang, eine 600 nm dicke AlYN-Schicht abzuscheiden. Diese Schicht mit Wurtzit-Struktur enthielt eine bis dato unerreichte Yttrium-Konzentration von über 30 Prozent. Vor Kurzem nun wurde ein weiterer Durchbruch erzielt: Es ist gelungen, AlYN/GaN-Heterostrukturen mit präzise einstellbarer Yttrium-Konzentration herzustellen, die sich durch hervorragende strukturelle Qualität und elektrische Eigenschaften auszeichnen. So verfügen die neuartigen Heterostrukturen über eine Yttrium-Konzentration von bis zu 16 Prozent. Unter der Leitung von Dr. Lutz Kirste führte die Gruppe für Strukturanalyse weitere detaillierte Analysen durch, um das Verständnis der strukturellen und chemischen Eigenschaften von AlYN zu vertiefen.
Jobangebote+ passend zum Thema

Darüber hinaus konnten die Fraunhofer-Forschenden bereits sehr vielversprechende und für den Einsatz in elektronischen Bauteilen interessante elektrische Eigenschaften von AlYN messen. »Wir konnten beeindruckende Werte für den Schichtwiderstand, die Elektronendichte und die Elektronenbeweglichkeit beobachten. Diese Ergebnisse haben uns das Potenzial von AlYN für die Hochfrequenz- und Hochleistungselektronik vor Augen geführt«, so Dr. Leone.
AlYN/GaN-Heterostrukturen für Hochfrequenzanwendungen
Dank seiner Wurtzit-Kristallstruktur lässt sich AlYN bei geeigneter Zusammensetzung sehr gut an die Wurtzit-Struktur von Galliumnitrid anpassen. Eine AlYN/GaN-Heterostruktur verspricht die Entwicklung von Halbleiterbauelementen mit verbesserter Leistung und Zuverlässigkeit. Zudem besitzt AlYN die Fähigkeit zur Induktion eines zweidimensionalen Elektronengases (2DEG) in Heterostrukturen bei einer Yttrium-Konzentration von etwa 8 Prozent.
Aus den Ergebnissen der Materialcharakterisierung lässt sich ableiten, dass AlYN in Transistoren mit hoher Elektronenbeweglichkeit (HEMTs) eingesetzt werden kann. So konnten die Forschenden einen signifikanten Anstieg der Elektronenbeweglichkeit bei niedrigen Temperaturen beobachten (mehr als 3000 cm2/Vs bei 7 K). Inzwischen hat das Team bereits bedeutende Fortschritte bei der Demonstration der epitaktischen Heterostruktur erzielt, die für die Herstellung erforderlich ist, und erforscht den neuen Halbleiter weiter im Hinblick auf die Herstellung von HEMTs.
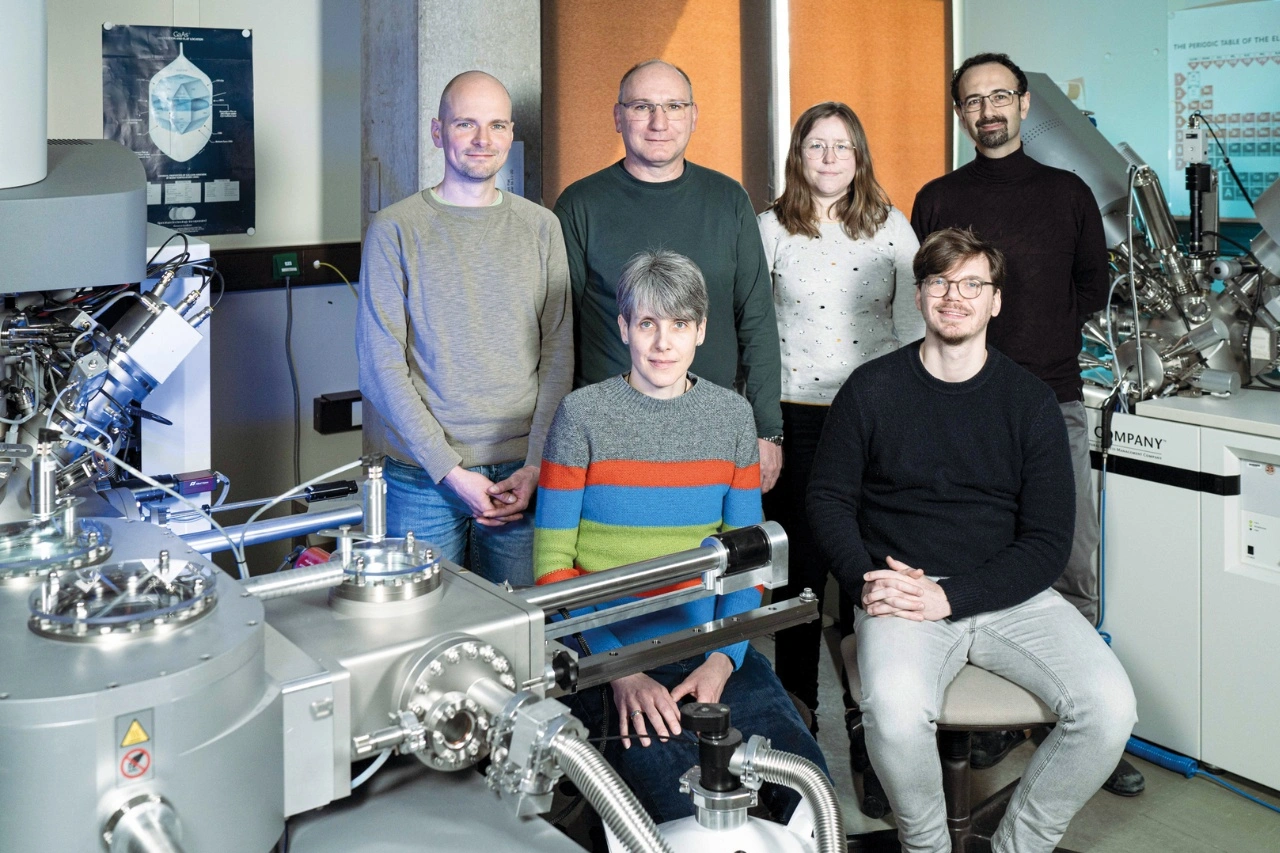
Auch für die industrielle Nutzung können die Forschenden in Freiburg bereits eine positive Prognose wagen: Bei AlYN/GaN-Heterostrukturen, die auf 4-Zoll-SiC-Substraten gewachsen sind, konnten sie eine Skalierbarkeit und strukturelle Gleichmäßigkeit der Heterostrukturen demonstrieren. Durch die erfolgreiche Herstellung von AlYN-Schichten in einem kommerziellen MOCVD-Reaktor ist die Skalierung auf größere Substrate in größeren MOCVD-Reaktoren möglich. Diese Methode gilt als die produktivste für die Herstellung großflächiger Halbleiterstrukturen und unterstreicht das Potenzial von AlYN für die Großserienfertigung von Halbleiterbauelementen.
Entwicklung nichtflüchtiger Speicher
Aufgrund seiner ferroelektrischen Eigenschaften eignet sich AlYN in hohem Maße für die Entwicklung nichtflüchtiger Speicheranwendungen. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass das Material keine Begrenzung der Schichtdicke aufweist. Daher regt das Forschungsteam am Fraunhofer IAF an, die Eigenschaften von AlYN-Schichten für nichtflüchtige Speicher weiter zu erforschen, da AlYN-basierte Speicher nachhaltige und energieeffiziente Datenspeicher vorantreiben können. Dies ist besonders relevant für Rechenzentren, die zur Bewältigung des exponentiellen Anstiegs der Rechenkapazität für künstliche Intelligenz eingesetzt werden und einen deutlich höheren Energieverbrauch aufweisen.
Oxidation als Herausforderung
Eine wesentliche Hürde für die industrielle Nutzung von AYN ist seine Oxidationsanfälligkeit, welche die Eignung des Materials für bestimmte elektronische Anwendungen beeinträchtigt. »In Zukunft wird es wichtig sein, Strategien zur Minderung oder Überwindung der Oxidation zu erforschen. Dazu könnten die Entwicklung hochreiner Vorläuferstoffe, die Anwendung von Schutzbeschichtungen oder innovative Herstellungstechnikgen beitragen. Bislang stellt die Oxidationsanfälligkeit von AlYN eine große Herausforderung für die Forschung dar, um sicherzustellen, dass die Forschungsanstrengungen auf die Bereiche mit den größten Erfolgsaussichten konzentriert werden«, fordert deshalb Dr. Leone.