Lagerung elektronischer Komponenten
Eine Alternative zum Redesign
Fortsetzung des Artikels von Teil 1
Tiefe Temperaturen helfen – aber nur bei genauer Regelung
Die einfache Antwort: bei tieferen Temperaturen lagern. Doch Vorsicht: So einfach, wie das klingt, ist es nicht, wie Krumme warnt: »Schlicht die Temperatur im Lagerraum zu senken kann auch viel kaputt machen.« Denn dann schlage gern einmal die Zinnpest zu: Es kommt zu einer internen Umkristallisierung. Das Ergebnis: Die Oberfläche löst sich, das Bauteil kann nicht mehr verarbeitet werden.
Solche Überraschungen vermeidet HTV mit dem TAB-Verfahren über vielfältige und den jeweiligen Bauelementtypen individuell angepasste Lagerungsprozesse. Es hat sich beispielsweise herausgestellt, dass bestimmte Temperaturprofile über die Zeit gefahren werden müssen – und zwar unterschiedliche Profile für unterschiedliche Komponenten wie etwa ICs, MEMS und OLEDs. Deshalb lagert HTV die Komponenten in speziell dafür eingerichteten Räumen eines Hochsicherheitsgebäudes ein. Es besteht aus drei Blöcken, die jeweils noch einmal in zwölf baulich getrennte Zonen aufgeteilt sind. Insgesamt steht eine Lagerfläche von 12.000 m2 zur Verfügung. Hier können die Komponenten, Baugruppen und Systeme unter verschiedenen, jeweils auf sie optimierten Bedingungen eingelagert werden.
Die Komponenten selbst werden in speziellen Tüten verpackt. Weil die Plastikteile, etwa von Steckverbindern oder Kabeln, flammhemmende Stoffe enthalten, die über die Zeit ausgasen, sind die Tüten mit einer absorbierenden Schicht versehen. Sie binden die Gase, die sonst die Metallteile der Bauelemente angreifen. Zudem gibt HTV kleine Beutel in die Tüten, in denen sich spezielle Absorbtionsmaterialien befinden, um weitere Schadstoffe aufzunehmen. »Wir verwenden viele verschiedene Stoffe in unterschiedlichen Mischungen; das ist das Know-how, das wir über viele Jahre erworben haben«, erklärt Krumme.
Jobangebote+ passend zum Thema
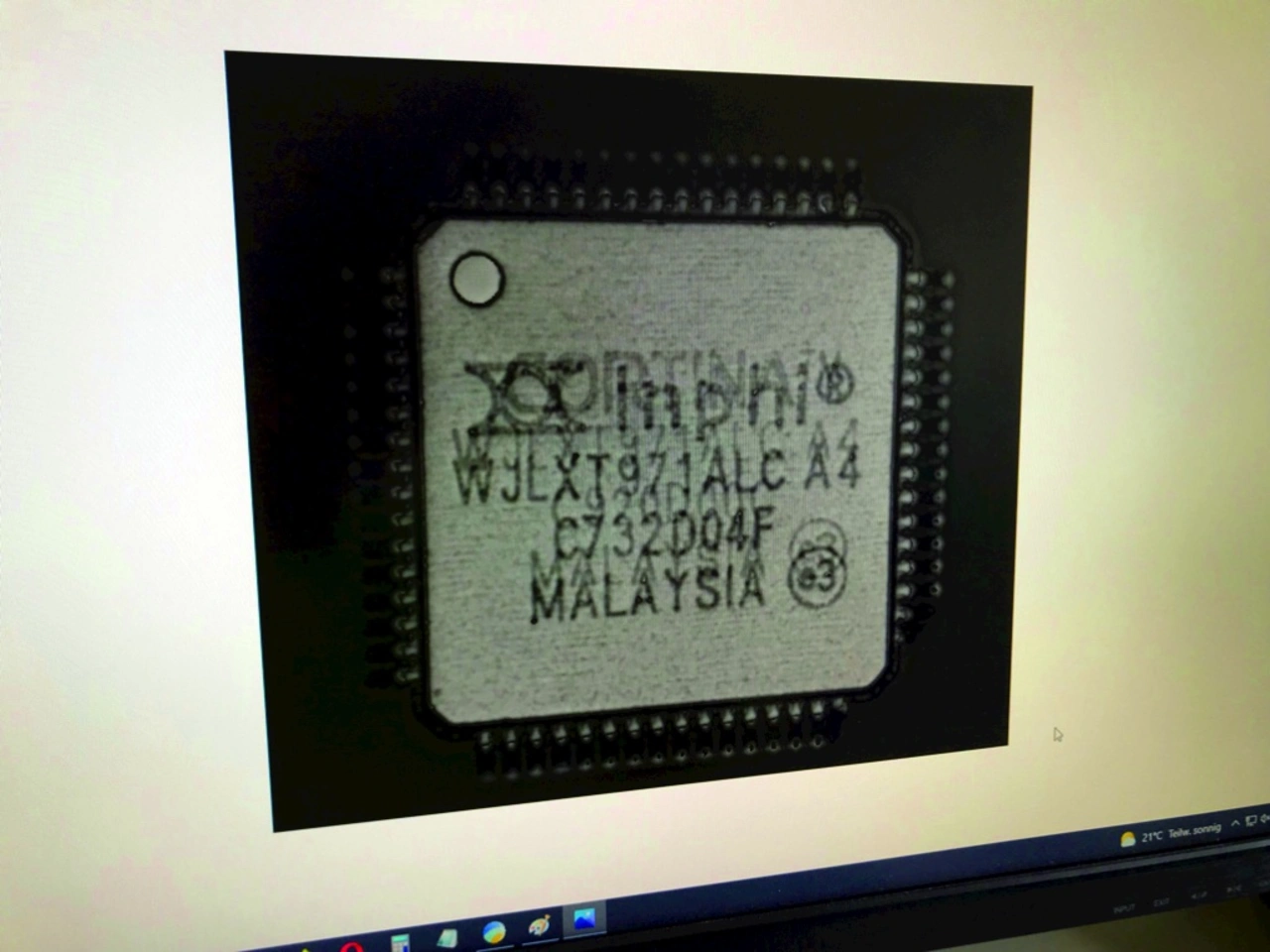
Die Rezepte müssen kontinuierlich weiterentwickelt werden
HTV entwickelt die Methoden ständig weiter, mit deren Hilfe die Alterungsprozesse aufgehalten werden. Beispielsweise auf dem Gebiet der OLEDs, die massiven Alterungsprozessen unterworfen sind und von denen immer wieder neue Typen auf den Markt kommen, die ein neues Alterungsverhalten aufweisen. In Steckverbindern ändern sich ständig die Kunststoffe, und die Materialien vieler Komponenten wechseln nicht zuletzt durch REACH. »Der Forschungsbedarf ist also insgesamt sehr hoch«, so Krumme. »Unsere Rezepte gegen die Alterung müssen wir kontinuierlich fortentwickeln.«
Doch auch die besten Rezepte gegen die Alterung nützen nichts, wenn im Laufe der langen Lagerzeit dem Gebäude etwas passiert. Eines der größten Risiken für die Langzeitlagerung ist ein Brand. Damit er erst gar nicht erst entstehen kann, werden die Lagerräume im Hochsicherheitsgebäude mit sauerstoffarmer Luft versorgt, wie sie in 4000 m Höhe herrscht. In dieser Atmosphäre erlöscht die Flamme eines von außen eingebrachten Feuerzeugs sofort. Menschen können sich dort aber ohne Schwierigkeiten aufhalten (für eine begrenzte Zeit), solange sie gesund sind.
Wer sich für die Langzeitlagerung interessiert, dem unterbreitet HTV auf Basis der Komponenten, ihrer Zahl und ihrer Verpackung ein erstes Angebot. Der Kunde erfährt, ob eine Lagerung überhaupt sinnvoll wäre, wenn ja, über wie viele Jahre und was sie kostet. Wenn er die Langzeitlagerung nutzen will, muss er sich nicht auf eine bestimmte Zeitspanne festlegen, er kann Jahr für Jahr neu darüber entscheiden.
Die Komponenten überwacht HTV kontinuierlich und überprüft ihren Zustand. Jedes Jahr erhalten die Kunden einen rund 60 Seiten starken Bericht. Die Berichte sind so abgefasst, dass sie untereinander vergleichbar sind und Prognosen erstellt werden können. Die Kunden sehen sofort, was sich geändert hat.
Langzeitlagerung als Teil des Obsoleszenzmanagements
Krumme hält es für unabdingbar, dass die Anwender von ICs ein proaktives Obsoleszenzmanagement betreiben, etwa Stücklistenanalysen durchführen, um Problemteile zu identifizieren, denen ein Last Time Buy droht. So kann auch ermittelt werden, ob es alternative Bauelemente gibt, wenn beispielsweise ein bestimmter Typ in vier Jahren abgekündigt wird. Kommt es dann günstiger, ein Redesign mit Neuqualifizierungen durchzuführen oder die Bauelemente einzulagern? Oder wäre es sogar besser, gleich die komplette Baugruppe auf Lager zu legen? Denn es ist ja nicht sicher, ob es in 15 Jahren EMS-Unternehmen gibt, die die alten Komponenten überhaupt noch bestücken können. »Das komplette Obsoleszenzmanagement durchzuführen ist aber für viele kleine und mittlere Unternehmen zu teuer. Deshalb unterstützen wir sie, falls es gewünscht ist, und ermitteln beispielsweise den Obsoleszenz-Status einer Baugruppe«, erklärt Krumme. So könne beispielsweise gut vorhergesagt werden, wie viele Bauelemente eingelagert werden müssen. »Wer das im Vorfeld nicht analysiert und zu wenig eingelagert hat, kann böse Überraschungen erleben.« Wer allerdings auf Obsoleszenzmanagement verzichtet und von einer Abkündigung überrascht wird, für den ist die Langzeitlagerung oft der einzige Ausweg.
Und wie lange lagern die Kunden die Bauteile ein? Das sei laut Krumme recht unterschiedlich; der Durchschnitt liege bei 10 bis 15 Jahren. »Wir lagern sie nicht nur, wir geben für sie auch Prognosen ab. Denn es kommt ja nicht nur darauf an, dass ein Bauelement die Zeit der Einlagerung schadlos überstehen muss, es muss ja noch einmal zehn Jahre im Gerät klaglos seinen Dienst tun.« Und er ist überzeugt, dass sich der kontinuierliche Forschungsaufwand gelohnt hat: »Wir lagern seit 15 Jahren ein, die Reklamationsquote ist exakt Null.«
- Eine Alternative zum Redesign
- Tiefe Temperaturen helfen – aber nur bei genauer Regelung