Additive Manufacturing of Electronics
»Wie wir 3D-Elektronik schneller in den Markt transformieren«
Fortsetzung des Artikels von Teil 1
Elektronik beschäftigen?
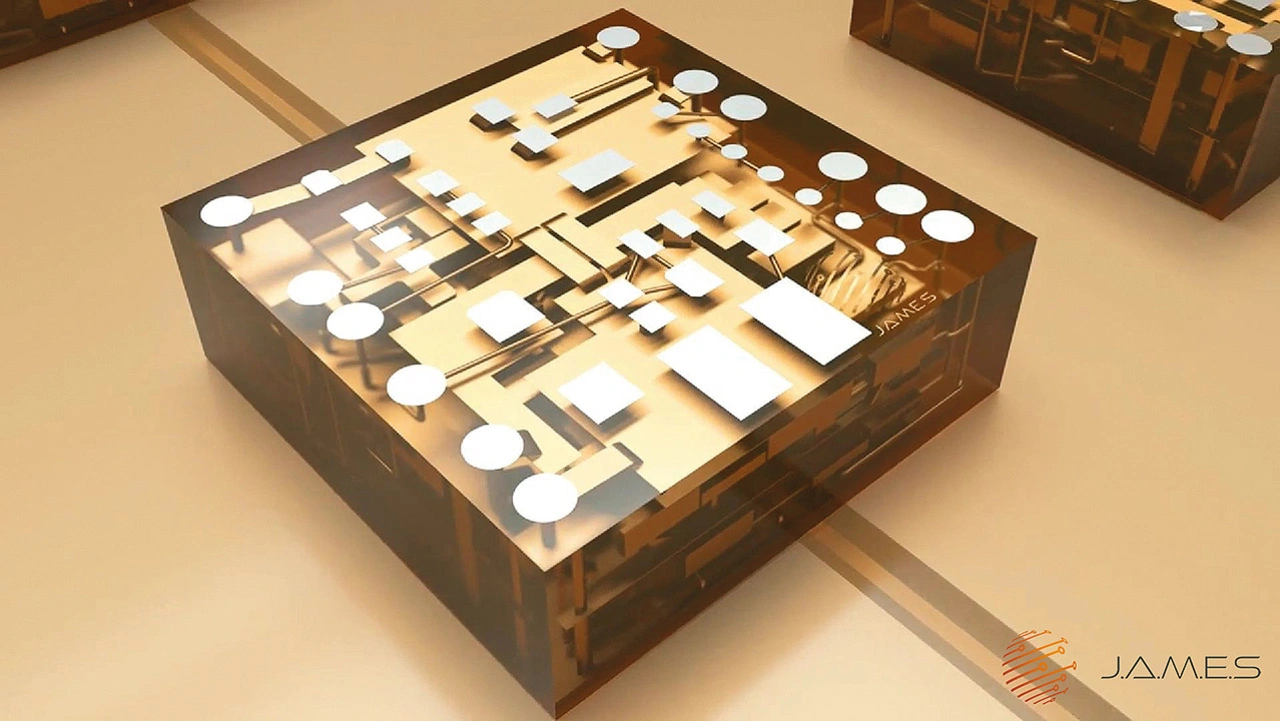
Es gibt doch bereits Unternehmen, die sich mit 3D-Druck in der
Ganz wichtig in dieser Diskussion: wir müssen differenzieren, welche Technologievariante gemeint ist. Zur additiven Elektronikfertigung zählt beispielsweise auch der Siebdruck, um leitende und isolierende Pasten oder Tinten aufzubringen.
Eine Variante davon, die In Moulded Elektronik (IME), wird schon erfolgreich im Großseriengeschäft für Automotive und andere Branchen produziert. Hier wird zunächst eine Folie bedruckt und dann in eine 2,5D-Form gebracht. Auch elektronische Bauteile können Bestandteil sein – etwa LEDs.
Oder der 3D-Druck für Löststoppmasken, z. B. an Finepitch-BGA-Anschlüssen mit Ballpitch von unter 0,4 mm. Zwei Leiterplattenhersteller in Deutschland bieten den additiv hergestellten 3D-Lötstopplack bereits für Serienleiterplatten an. Hier beginnt übrigens die Klasse 1 unserer fünfstufigen Klassifizierung.
Und ja, es gibt Pioniere der additiven Elektronikfertigung in Deutschland, wie die Firmen NeoTech AMT oder Nano Dimension. Auch in unserem Arbeitskreis sind Mitgliedsfirmen, die sich damit intensiv beschäftigen. Wir sind dabei, weitere Arbeitsgruppen zu formieren, die sich speziell mit den Themen 3D-eCAD-Tools und Datenformate beschäftigen werden.
Wie können diese Unternehmen überhaupt Produkte fertigen, wenn die eCAD-Tools dazu weitgehend fehlen?
Wie gesagt, einfache Leiterstrukturen können auch mit dem mCAD-Tool gezeichnet werden. Einige unserer Mitglieder entwickeln mit ihrem CAD-Partner Add-On-Funktionen zu den bestehenden eCAD-Tools. So kann man beispielsweise mäanderförmige Leiterbahnen für dehnbare Verbindungen realisieren.
Bei GED haben wir schon vor über zehn Jahren mit Workarounds das VAD-System so erweitert, das wir ein hochintegriertes 3D-Kameramodul mit 3D-CSP realisiert haben. Es gab drei Bauteilebenen und Leiterbahnen auf 14 Lagen mit 20 µm schmalen Leiterzügen. Die Gerberdaten wurden dann aufwendig in STL-Daten umgesetzt. Mit Erfahrung und kreativen Verbiegen der Tools geht natürlich schon einiges. Nur, das ist sehr aufwendig und natürlich auch fehlerbehaftet.
Also entwickelt die EDA-Branche immer noch zu wenig in Richtung additive Fertigung für die Elektronik?
Jobangebote+ passend zum Thema
So pauschal kann man das auch nicht sagen. Wie erwähnt, es gibt Ausnahmen. Sicherlich ist die EDA-Branche nicht allein schuld, dass alles nur zögerlich voranschreitet. Es liegt auch an den Entwicklern in den Elektronikfirmen selbst. Viele Entwickler haben das Potenzial der additiven Fertigung für sich häufig noch nicht erkannt. Wir können heute beispielsweise verdrehte oder geschirmte Leitungen in den Verbindungsträger drucken. Das ändert sehr viel!
Allerdings muss interdisziplinär gedacht werden. Es geht es nicht mehr nur um reine Elektronik. Es geht auch um Mechanik und vor allem um die Planung der Produktion: Welche Fertigungsprozesse braucht es? Welche Maschinen werden dafür benötigt? Das ist für alle Neuland und es gibt bisher nur wenige, die das können. Und natürlich geht die Qualifikation der Prozesse und Zuverlässigkeit nicht von heute auf morgen.
Warum ist es überhaupt so schwierig, mCAD und eCAD unter einen Hut zu bringen?
Es gab ja in der Vergangenheit sogar CAD-Tools, wie von Intergraph ein mCAD-Tool mit weiterentwickelten Modulen für PCB und sogar für Additiv-Keramik-Lösungen. Nur die haben sich im Elektronikmarkt nicht durchgesetzt. Man hat sich dann über die Jahre mit mehr oder weniger einfachen Interface-Lösungen beholfen, die IDF oder STEP-Format im eCAD importieren können.
Jetzt ist die Herausforderung noch größer. Ein 3D-Drucker kann mit ODB++ oder dem Gerber-Format nichts anfangen. Wir müssen uns überlegen, wie wir die Fertigungsdaten für die unterschiedlichen Maschinen und Prozessschritte aus dem eCAD-System herausbekommen.
In Japan gab es Bestrebungen für ein 3D-eCAD-Format, die leider eingestellt wurden. Das Thema ist komplex. Alleine die CAD-Modelle von Bauteilen benötigen für das Embedding viel mehr Informationen und die Materialien müssen mit Daten hinterlegt werden können. Die Arbeitsgruppe 3D-Elektronik mit additiver Fertigung hat sich zum Ziel gesetzt, daran mitzuarbeiten und im FED Normen- und Standards zu erarbeiten. Der FED arbeitet seit Jahren in verschiedenen Gremien von IPC und IEC aktiv mit.
Sind denn in Deutschland die Voraussetzungen gegeben, um in der additiven Fertigung durchstarten zu können?
An sich schon! Sowohl ganz große Unternehmen als auch die typischen KMU sind hier unterwegs. Kreativität, Ideen und interdisziplinäres Arbeiten sind also schon vorhanden. Was damit möglich ist, führen einige Unternehmen auch schon vor. Es gab tolle Forschungsprojekte von Festo, wo auf Bionik basierende Prototypen entwickelt wurden. Möven, die fliegen, Ameisen mit Schwarmintelligenz, Roboter-Libellen u. a. die allerdings nicht additiv, sondern mithilfe der werkzeugbasierenden 3D-MID-Technik gefertigt wurden.
Bei den Forschungsinstituten gibt es eine Vielzahl von öffentlich geförderten F&E-Projekten. Forscher in Aachen, Berlin, Chemnitz, Dresden, Karlsruhe, Stuttgart und anderen Instituten entwickeln bereits seit Jahren Systeme und Materialien für die additive Fertigung. Es bleibt zu hoffen, dass es einige in die industrielle Umsetzung schaffen. Dafür braucht es kreative und mutige Unternehmer und Anleger.
Aus dem Arbeitskreis heraus haben wir dafür auch ein Innovationsnetzwerk gegründet. Im Netzwerk gibt es einen Förderberater, der hilft, Partner zusammenzubringen und Förderanträge für öffentliche Mittel zu beschaffen. Bisher konnten bereits fünf Förderprojekte erfolgreich umgesetzt werden.
Doch die anderen Regionen schlafen natürlich nicht: In den USA gibt es sehr viele 3D-Elektronikentwicklungen in der Medizintechnik oder Robotik für militärische Anwendungen. Hierfür stehen sehr große Summen für die Forschung und Entwicklung zur Verfügung. In Europa ist Großbritannien auch schon sehr weit und auch in Südeuropa und Benelux gibt es Unternehmen, die bereits Serien additiv produzieren.
Zunächst werden die 3D-Produkte Erfolg haben, die entweder eine ganz neue Möglichkeit bieten, oder z. B. durch eine »funktionale Integration« und absolute Verkleinerung eine besonders hohe Performance ermöglichen. Der Preis für die Funktion pro Kubikmillimeter oder Gramm ist z. B. in der Luftfahrt oder bei Fluggeräten sehr bedeutend.
Die Anwendung in Hörgeräten oder Hearables ist natürlich auch prädestiniert für die 3D-Integration. Die Möglichkeiten mit intelligenten Prothesen oder gar 3D-gedruckten Organen mit Elektronik und Sensorik, wie sie heute schon als mechanisches Model 3D-gedruckt werden, wird künftig sehr hohe Verkaufspreise erzielen. Aufgrund der langwierigen Medizinproduktzulassung dürfte das jedoch noch zehn Jahre dauern. Es gibt auch Beispiele in der Veterinärmedizin wo bereits 3D-gedruckte Prothesen mit integrierter Elektronik und Sensorik für besonders teure Rennpferde zu einem sehr guten Preis verkauft werden.
Unser White Paper enthält auch Prognosen aus Marktstudien zum weltweiten Wachstum der additiven Elektronikfertigung. In den deutlichen Wachstumsprognosen bis 2030 liegen wir in Deutschland und Europa zwar weit hinter Nordamerika, aber gleich zu China. Wir werden hier keine 50 Millionen InEar-Kopfhörer oder Alexas additiv produzieren, sondern eher die Produkte, die aufgrund besonderer Leistungseigenschaften für Medizintechnik, Luftfahrt oder Maschinenbau einen hohen Preis erzielen können.
Ein anderer zunehmend wichtiger Aspekt ist die Nachhaltigkeit oder der CO2-Fußabdruck. Mit additiver Technik kann man viel sparsamer fertigen als mit subtraktiver Technik. Im Kontext des »Digitalen Zwillings« kann damit ab Serienstückzahl »1« gefertigt werden – ohne teure Werkzeuge und mit erheblich reduzierter Lagerhaltung.
Sie arbeiten im Hauptberuf als Geschäftsführer von GED.
Was bringen Sie im eigenen Unternehmen in Richtung additive Fertigung auf den Weg?
Wir haben seit 2015 schon an mehreren 3D-Elektronikprojekten mitgearbeitet, beispielsweise an dem F&E Projekt »Freiform-Elektronik« zusammen mit dem Fraunhofer IZM und Schaeffler. Mit einem 3D-Multimaterialdrucker haben wir unsere ersten Erfahrungen für die Entwicklung und Produktion sammeln können. Es folgten weitere F&E-Kooperationen z. B. mit Philips, KOB und dem Fraunhofer EMFT in einem Projekt für ein elektronisches Sensorpflaster (SensorPatch) zur Versorgung chronischer Wunden. Bei diesen Projekten ging es um funktionale Integration und Miniaturisierung mittels additiver Verfahren.
Seit letztem Jahr kooperieren wir mit dem Foliensensorhersteller Accensors. Das Ziel der Zusammenarbeit ist, aus unseren beiderseitigen Baukastenlösungen schnell neue preisgünstige Sensorlösungen zu entwickeln. Der IoT-SensorNode-Baukasten von GED besteht aus fingernagelgroßen Leiterplatten mit dem ein Multisensorsystem einfach konfigurierbar ist. Die SensorNodes haben u. a. Bluetooth Low Energy und ein intelligentes Batteriemanagement für autarke Sensorlösungen. Die Firma Accensors entwickelt Foliensensoren, die unterschiedlichste Werte und Vitaldaten am Patienten messen können. Sensorpatches, die Ph-Wert, Dehydration und andere elektrochemische Werte im Schweiß oder Blut messen können, werden gerade entwickelt. Sowohl für IoT als auch für die Medizintechnik sind diese Lösungen aktuell stark gefragt. GED hat jetzt ein weiteres Steckmodul entwickelt, für die elektrochemischen hochempfindlichen Messungen, amperometrisch, voltametrisch und Bioimpedanz.
Der Vorteil der »Smart Patch Produkte« – sie sind so preisgünstig, dass sie nach dem Gebrauch entsorgt werden können. In diesem Projekt punktet GED mit Erfahrung und der Zulassung nach ISO13485 als Entwickler und Hersteller für Medizinprodukte.
Wir sind überzeugt, dass die beiden Baukastenlösungen für Sensorik und Auswerteelektronik einen hohen Nutzen für die schnelle Umsetzung von Kundenprodukten bieten. Die Folien können entweder von der Rolle mit dem SMD-Automaten bestückt oder als Multisensoren kundenspezifisch hergestellt werden. Hier spielen schon heute die Verfahren der additiven Fertigung eine große Rolle. Beispielsweise findet diese Technik eine Einordnung in der Klasse 3. Wenn elektronische Bauteile mit in die Folie integriert werden, reden wir über Klasse 4.
- »Wie wir 3D-Elektronik schneller in den Markt transformieren«
- Elektronik beschäftigen?
- Zeichnen sich weitere interessante Zukunftsprojekte ab?