Smart Grid: Operation am offenen Herzen
Eine HGÜ-Pilotanlage wäre sehr hilfreich
Fortsetzung des Artikels von Teil 1
HGÜ unter der Erde?
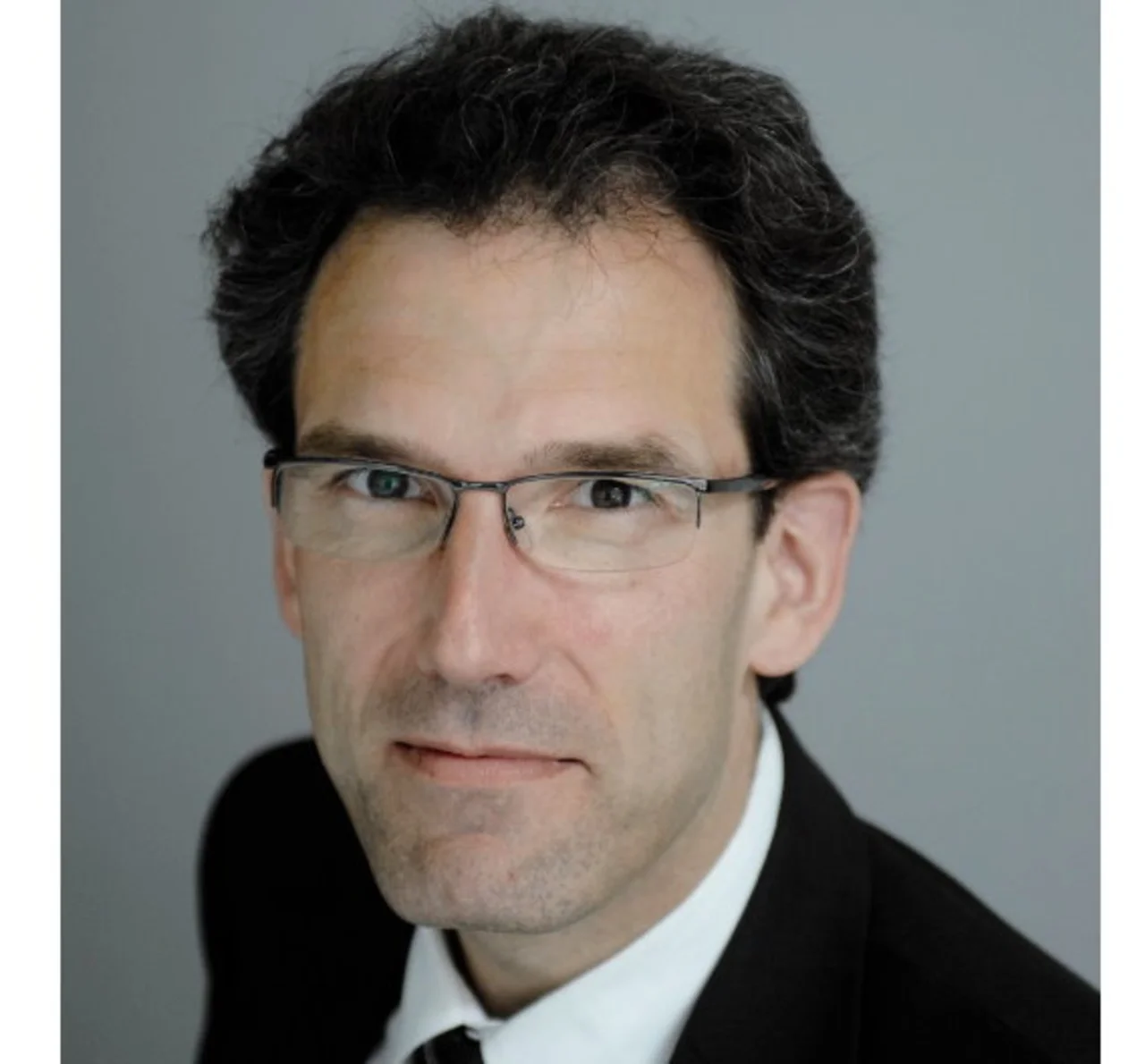
Zu den bisher noch nicht betrachteten technischen Optionen zählen unterirdisch verlegte HGÜ-Kabel. Auch hier gibt es schon Erfahrungen, denn in großen Offshore-Windparks bleibt nichts anderes übrig, als Kabel zu verlegen. ABB hat im Auftrag des Übertragungsnetzbetreibers transpower das 200 km lange HGÜ-Kabel BorWin 1(150 kV, 400 MW) verlegt, um die Windräder des Offshore-Windparks BARD Offshore 1 an das europäische Verbundnetz anzuschließen. Das Kabel verläuft über 125 km unter Wasser, 75 km sind unterirdisch bis nach Diele verlegt, von wo nun der Strom über die umstrittene, im Bau befindliche Leitung nach Wesel am Niederrhein weitergeführt werden soll.
Die Befürworter der HGÜ-Kabel-Alternative führen ins Feld, dass die unter der Erde verlegten HGÜ-Leitungen die Landschaft nicht so verschandeln wie Freileitungen und auch die gesundheitlichen Auswirkungen (falls es sie gibt), weniger stark seien.
Allerdings warnt Menke, vor allzu viel Euphorie, denn erstens kann ein HGÜ-Kabel nicht mehr als 1,2 GW übertragen und zweitens stellt ein unterirdisch verlegtes HGÜ-Kabel eine technische Herausforderung dar. Außerdem handelt sich um ein großes Bauwerk, das durchaus Auswirkungen auf die Natur hat: Auch für ein Kabel müssen Schneisen durch den Wald gelegt werden. Ackerflächen, unter denen das Kabel verläuft, können nicht bearbeitet werden. Die Trasse muss für schweres Gerät zugänglich sein, und die Kosten liegen deutlich über denen von Freileitungen.
750 kV als Alternative?
Eine weitere, kürzlich ins Spiel gebrachte Möglichkeit bestünde darin, bei der Drehstromübertragung zu bleiben, dafür aber auf 750 kV hochzugehen. Der Vorteil gegenüber HGÜ läge darin, dass sich der Anschluss an das existierende Netz einfacher gestaltet. Eine 6-GW-HGÜ-Leitung ans bestehende Netz anzuschließen, bedeutet nämlich einen nicht unerheblichen Aufwand. 6 GW, das entspricht immerhin dem Doppelten der europäischen Regelreserve. Zum Vergleich: Die Stromrichterstation Diele („nur“ 400 MW) ist 74 m lang, 38 m breit und 14 m hoch.
Erfahrungen sammeln – möglichst bald
»Um nicht in einer Sackgasse zu landen, müssen wir mindestens bis 2050 in die Zukunft schauen, eher noch darüber hinaus und wir brauchen Pilotprojekte, auch wenn sie zunächst einmal teuer sind«, erklärt Dr. Peter Menke. Und diese Pilotprojekte sollten ergebnisoffen sein, denn nur so können man Erfahrungen sammeln auf deren Grundlagen dann Entscheidungen getroffen werden, die die Weichen für die nächsten 40 bis 80 Jahre stellen.
Um überhaupt planen zu können, wäre es erforderlich, sich mit der Politik auf einen Rahmen zu einigen. »Und weil die Zeit drängt, müssen wir sehr schnell zu einem Konsens kommen«, so Menke.
Vor allem sei es laut Dr. Christoph Dörnemann, Leiter Asset-Planung von Amprion, zunächst erforderlich, zu erforschen, welche Voraussetzungen überhaupt erfüllt werden müssen, um in Europa ein Overlay-Netz zu bauen. In Pilotprojekten müsse geklärt werden, welche Technologien zum Einsatz kommen und wie sie sich mit den vorhandenen Techniken kombinieren lassen. Es müsse aber auch geklärt werden, welche Auswirkungen das auf das Genehmigungsrecht in Europa hat und was der Regulator überhaupt anerkennt. In einem Punkt sind sich alle einig: Die ersten Schritte müssen jetzt gemacht werden, der Handlungsdruck ist da.
Insgesamt ist das eine gute Nachricht für die Industrie: Das größte Verbundsystem der Welt funktionier recht gut, alle Beteiligten verfügen über viel Erfahrung und befinden sich deshalb in einer guten Ausgangsposition, um das Netz so ausbauen zu können, dass es den Anforderungen der Erneuerbaren Energien künftig erfüllt.
Fazit: Es ist zwar einiger Gehirnschmalz erforderlich, um das deutsche bzw. europäische Verbundnetz so fit zu machen, dass es die Einspeisung aus den fluktuierenden Quellen erneuerbarer Energien verkraftet, aber die Techniker sind sich sicher, die Probleme lösen zu können.
Wo die wirklichen Hürden liegen, lesen Sie hier.
Jobangebote+ passend zum Thema
- Eine HGÜ-Pilotanlage wäre sehr hilfreich
- HGÜ unter der Erde?