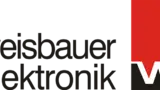Nachhaltigkeit
Von der Batterie lernen
Um zirkuläre Geschäftskonzepte im Batteriebereich zu etablieren, wird in der Europäischen Union der Digitale Produktpass eingeführt. Auch andere Industriezweige – etwa die Leistungselektronik – könnten von solch einem Konzept profitieren.
Vor zwanzig Jahren zwang die RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, die den Einsatz von Gefahrenstoffen einschränkt, die Elektronikindustrie dazu, sich nach Alternativen umzusehen, um die jahrzehntelang zum Löten verwendete eutektische Zinn-Blei-Legierung zu ersetzen. Seitdem sind viele Verordnungen in Kraft getreten, die den Einsatz von Gefahrenstoffen regulieren, und wir alle haben uns an RoHS, REACH, TSCA und andere Richtlinien gewöhnt.
Darüber hinaus wuchs das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und die bestmögliche Nutzung natürlicher Ressourcen. Dies bewog Regierungen, Behörden und die Industrie, sich Gedanken darüber zu machen, wie ein zirkuläres Geschäftskonzept entwickelt werden kann, das Elemente aus dem Cradle-to-Cradle-Konzept integriert und einen optimalen Weg definiert. Ziel ist es, ein Produkt von seiner Entstehung, seinen Inhaltsstoffen, seiner Konformität mit Umweltvorschriften, seiner Reparaturfreundlichkeit oder seiner endgültigen Entsorgung und Wiederverwertung zu verfolgen. Dies geschah im März 2022 durch die Europäische Kommission im Rahmen des European Green Deal [1]. Ähnliche Initiativen in den USA folgten. Aber worum geht es dabei?
Nachdem zehn Jahren lang auf lokaler Ebene Initiativen ergriffen worden waren, legte die Europäische Kommission im Rahmen des Europäischen Green Deals ein Maßnahmenpaket vor. Nachhaltige Produkte sollen in der Europäischen Union zur Regel werden. Ziel ist es, von der konventionellen linearen Wirtschaft wegzukommen und zirkuläre Geschäftsmodelle zu fördern sowie die Verbraucher zu befähigen, den ökologischen Umbruch voran- zutreiben (Bild 1). Dazu gehört auch der sogenannte Digitale Produktpass (DPP) [2].
An diesem Punkt drängt sich die Frage auf, was dies mit Leistungselektronik zu tun habe und wie die Stromversorgungsbranche von dieser neuen Anforderung betroffen sein könnte. Wo liegt die Grenzlinie zwischen einem Point-of-Load-Wandler, einer Stromversorgung mit mehreren Kilowatt oder gar einem Elektrofahrzeug? Welches Segment der Leistungselektronik muss den DPP beachten? Zur Beantwortung dieser Frage ist es hilfreich, den Digitalen Produktpass besser zu verstehen und zu ergründen, was dieser eigentlich bedeutet.
Den gesamten Lebenszyklus im Blick
Der Entwurf für die Ökodesign-Richtline für nachhaltige Produkte befasst sich mit dem Produktdesign, denn dort werden bis zu 80 Prozent der Ökobilanz eines Produkts festgelegt. Mit der Ökodesign-Richtline sollen neue Anforderungen gelten, um Produkte langlebiger, zuverlässiger, wiederverwendbar, nachrüstbar oder reparaturfähig zu machen, sie einfacher zu warten, aufzubereiten und zu recyceln. Außerdem soll dies energie- und ressourceneffizient erfolgen. Darüber hinaus wird durch produktbezogene Informationspflichten sichergestellt, dass die Verbraucher über die umweltrelevanten Auswirkungen ihrer Einkäufe informiert sind.
Alle regulierten Produkte erhalten einen Digitalen Produktpass, um die Reparatur oder das Recycling zu erleichtern und bedenkliche Stoffe entlang der Lieferkette zurückverfolgen zu können. Mit dem Pass sollen Herstellern und anderen wichtigen Akteuren der Lieferkette sowie Verbrauchern und Marktaufsichtsbehörden relevante Informationen zur Verfügung stehen, um die Nachhaltigkeit der Produkte zu gewährleisten. Wenn diese Digitalen Produktpässe gut konzipiert und auf bestehende Initiativen der Industrie abgestimmt sind, könnten sie dazu beitragen, die Kreislaufwirtschaft und kreislauforientierte Geschäftsmodelle zu fördern.
Dies mag recht hypothetisch und sogar komplex klingen, aber es gibt ein praktisches Beispiel aus dem boomenden Segment der Energiespeicherung und Batterien.
Vorbild Batterieindustrie
Seit 2006 unterliegen Batterien und Altbatterien in der EU den Bestimmungen der Batterierichtlinie (2006/66/EG). Die Nachfrage nach Batterien wird durch Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung angekurbelt und soll bis 2030 um das 14-Fache ansteigen. Da die Nachfrage nach Batterien weltweit exponentiell ansteigt, wird auch die Nachfrage nach Rohmaterialien entsprechend zunehmen. Daher ist es notwendig, die umweltrelevanten Auswirkungen von Batterien zu minimieren.
Vor dem Hintergrund, dass die langfristige Nachhaltigkeit der Batterieindustrie sehr wichtig ist, starteten 2017 zwei große Initiativen in Europa und den USA. Beide hatten ein ähnliches Ziel: die Entwicklung einer innovativen, wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Wertschöpfungskette für Batterien in Europa und den USA unter Berücksichtigung der ökologischen und gesellschaftlichen Aspekte.
Am 11. Oktober 2017 lud die Europäische Kommission führende Vertreter der Automobil-, Chemie- und Maschinenbauindustrie nach Brüssel ein, um die Batteriefertigung in der EU zu stärken und ein europäisches Ökosystem zu entwickeln, um die Abhängigkeiten und Risiken in der Lieferkette für das Herzstück der Energiewende und Elektrifizierung zu verringern. Daraufhin wurde die Europäische Batterie-Allianz (EBA, [3]) ins Leben gerufen, die als Teil des ökologischen und digitalen Wandels in Europa eine Schlüsseltechnologie darstellt, da Batterien für die Wettbewerbsfähigkeit des Automobilsektors unerlässlich sind. Im selben Jahr wurde auf dem Weltwirtschaftsforum eine öffentlich-private Kooperationsplattform für die USA gegründet, um bis 2030 eine nachhaltige Wertschöpfungskette für Batterien zu schaffen: die Global Battery Alliance (GBA, [4]).
2017 war somit das Jahr, in dem die EU und die USA den Grundstein für die Batterieindustrie legten, indem sie die Grundprinzipien für den DPP und ein völlig neuartiges Verfahren festlegten, das den gesamten Lebenszyklus aller Batterien (d. h. Industrie-, Automobil-, Elektrofahrzeug- und Gerätebatterien) auf diesen beiden Märkten umfasst. Innerhalb dieser Kette haften die Akteure aus der Industrie für die von ihnen bezogenen Materialien, die eingeschränkte Verwendung von Gefahrstoffen, den Mindestgehalt an recycelten Materialien und den CO2-Fußabdruck. Außerdem sind sie für die Leistungsfähigkeit, die Haltbarkeitsdauer und die Kennzeichnung verantwortlich und müssen die Zielvorgaben für die Rücknahme und das Recyceln bzw. die Wiederverwendung erfüllen. Der Gesamtprozess ist sehr komplex, und beide Allianzen haben ein standardisiertes Verfahren entwickelt, dessen ultimative Verkörperung der Digitale Produktpass ist.
Von der Idee zur Praxis
Wie die EU-Kommission im März 2022 im Rahmen ihres Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft »Ökodesign für nachhaltige Produkte« (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR, [5]) vorstellte, wird der digitale Produktpass alle Stufen der Wertschöpfungskette abdecken. Er wird kontinuierlich aktualisiert und begleitet das Produkt während seines gesamten Lebenszyklus (Bild 2). Ebenfalls erwähnenswert ist die Ankündigung der EU-Kommission und des US-Energieministeriums (DOE), dass die Europäische Batterie-Allianz und die US-amerikanische Global Battery Alliance gemeinsam robuste Lieferketten für Lithium-Ionen-Batterien und Batterien der nächsten Generation einschließlich der kritischen Rohstoffsegmente entwickeln werden. Eine saubere Energiewirtschaft zu fördern und die Wertschöpfungskette für Batterien zu festigen, hat für beide Wirtschaftsräume höchste Priorität.
Auf europäischer Ebene hat sich am 25. April 2022 ein Konsortium aus führenden deutschen Unternehmen und der Wissenschaft zusammengeschlossen und den Batteriepass [6] vorgestellt, um EU-weit Daten zu Traktionsbatterien für eine zirkuläre Wirtschaft bereitzustellen. Ein technologisches Merkmal des Projekts ist es, eine umfassende Lösung für den sicheren Austausch von Informationen und Daten zwischen verschiedenen Organisationen und Teilnehmern der Wertschöpfungskette im Bereich der Antriebsbatterien bereitzustellen, die auf verbindlichen standardisierten Datensätzen und einem interoperablen technischen Implementierungsansatz basiert, der die EU-Verordnung erfüllt.
Im Oktober 2022 gab die GBA das Greenhouse Gas Rulebook [7] als ersten Indikator für den Batteriepass in den USA bekannt. Dieser besteht aus:
- Einem globalen Melderahmen, der Vorschriften für die Messung, Prüfung und Meldung von ESG-Kennzahlen in der gesamten Wertschöpfungskette von Batterien enthält.
- Einer digitalen Batterie-ID, mit der Daten und Beschreibungen über die Umweltbilanz, die Herstellungsgeschichte und die Herkunft einer Batterie sowie eine verlängerte Batterielebensdauer und das Recycling ermöglicht werden.
- Harmonisierung der digitalen Systeme, die über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg Daten an den Batteriepass sammeln.
- Eine digitale Plattform, die Daten sammelt, austauscht, zusammenführt und an alle autorisierten Akteure im Lebenszyklus weiterleitet, um eine nachhaltige Wertschöpfungskette für Batterien für Elektrofahrzeuge und stationäre Anlagen zu fördern. Transparent soll die Plattform über Fortschritte informieren, um die Regierungen und die Öffentlichkeit bei der politischen Entscheidungsfindung zu unterstützen und Benchmarks für die Leistung zu entwickeln (Bild 3).
- Ein Gütesiegel für Batterien (basierend auf den an die Plattform gemeldeten Daten), um den Verbrauchern zu helfen, verantwortungsvoll einzukaufen.
Diese Beispiele belegen das große Engagement der Batteriebranche bei der endgültigen Umsetzung des DPP, das auch für andere Branchen der Leistungselektronik als Geschäftsmodell dienen könnte.
Blick auf die Leistungselektronik
Was die Batterieindustrie betrifft, so nahm Powerbox im Jahr 2017 an einem Workshop über die zukünftige Entwicklung der Stromversorgungsindustrie teil. Ziel war es, Abfälle zu reduzieren und Teil des damaligen Projekts, der Ökodesign-Richtlinie für nachhaltige Produkte, zu werden. In einem Weißbuch »Will the power supply industry adopt the cradle-to-cradle business model?« legte Powerbox seine Vorstellungen darüber dar, was die Norm werden könnte [8].
Noch sind wir wohl ein paar Jahre davon entfernt, dass die Stromversorgungsbranche das Konzept des Digitalen Produktpasses übernimmt, aber man sollte dies im Hinterkopf behalten, und es könnte schneller passieren, als wir meinen.
Literatur
Der Grüne Deal: Neue Vorschläge, um nachhaltige Produkte zur Norm zu machen und Europas Ressourcenunabhängigkeit zu stärken, https://tinyurl.com/37juduej, Europäische Kommission, 30. März 2022
The Ecosystem Digital Product Passport (CIRPASS), https://tinyurl.com/24n7ef2y, DigitalEurope
European Battery Alliance, https://www.eba250.com/
Global Battery Alliance, https://www.globalbattery.org/
Ökodesign für nachhaltige Produkte, https://tinyurl.com/2p8se2em, Europäische Kommission
EU Battery Pass, https://thebatterypass.eu/
GBA Battery Passport Greenhouse Gas Rulebook, https://tinyurl.com/2p8644px, Global Battery Alliance, 5. Oktober 2022
Will the power supply industry adopt the cradle-to-cradle business model?, https://tinyurl.com/s3vbz67u, White Paper WP012, Powerbox