12. Compamed Frühjahrsforum
»Implantate in der Medizintechnik«
Fortsetzung des Artikels von Teil 1
Aktive Implantate für personalisierte Neuroprothetik
Ein wichtiges Feld zum Einsatz von aktiven Implantaten ist die Neuroprothetik. In diesem Bereich hat die CorTec eine Close-Loop-Technologie zur Messung und Stimulation von Gehirnaktivität für den Langzeit-Einsatz entwickelt. »Grundlage unserer Aktivitäten ist die Erkenntnis, dass derartige Therapien personalisiert werden müssen«, sagt Dr. Martin Schüttler, Gründer und Geschäftsführer von CorTec. Das Brain Interchange-Konzept basiert auf drei Komponenten: Elektroden zur Ableitung und Stimulation des Nervensystems, der Telemetrie-Einheit zur optischen Kommunikation mit dem Implantat sowie der Computer-Einheit, die die Hirnsignale in Echtzeit auswertet, um den aktuellen Stimulationsbedarf des Patienten zu ermitteln. Die Elektroden stellt das Unternehmen selbst her. Sie bestehen aus fünf Schichten, die mit ultrakurz gepulsten Lasern und Methoden der Mikrofabrikation gefertigt werden. Dadurch lassen sie sich in jeder geometrischen Form (auch dreidimensional oder im Cuff-Design), mit hoher Kontaktdichte sowie für vielfältige Anwendungen produzieren.
Unter Elektrospinnen versteht man die Herstellung von meist sehr dünnen Fasern aus Polymerlösungen durch die Behandlung in einem elektrischen Feld. Diese Methode wendet das zum Beispiel das Unternehmen Statice auch an, um neue Designmöglichkeiten für die Entwicklung und Herstellung von fortschrittlichen medizinischen Bauteilen zu schaffen. Voraussetzung dafür sind kontrollierte Bedingungen hinsichtlich Temperatur, Feuchtigkeit und Partikel. Durch Verwendung verschiedener Düsen lassen sich unterschiedliche Lösungen erreichen: Röhren mit komplexer Form, besonders dünne Röhren oder pflasterartige Flächen. Anwendung finden sie bei der Beschichtung von metallischen Implantaten, der Filtration, der Medikamentenverabreichung sowie der Hautregeneration. Beim Drug Delivery ist zum Beispiel denkbar, die Wirkstoffe in die Fasern zu laden und kontrolliert freizugeben.
Degradierbare Werkstoffe für Selbstauflösung des Implantats
Bei vielen Implantaten geht es um eine möglichst lange Lebensdauer, bei manchen aber auch darum, dass sie nicht dauerhaft im Körper verbleiben. Am Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM wurde als Lösung für die Behandlung größerer Knochendefekte ein degradierbares Magnesiumimplantat mit einer Faserstruktur entwickelt. Diese dient dem Knochen als Leitstruktur während des Wachstums, das durch die günstigen biomechanischen Eigenschaften des Implantats besonders stimuliert wird. Gleichzeitig ermöglicht die Struktur das Einwachsen der Blutgefäße. Parallel mit dem Heilungsprozess baut sich das Implantat ab.
Bisher wurden größere Knochenschäden hauptsächlich durch patienteneigene Knochen implantologisch versorgt. Allerdings steht dieser natürlich nur begrenzt zur Verfügung. Außerdem birgt die Entnahme - zumeist aus dem Beckenkamm - zusätzliche Risiken für den Patienten. Eine Alternative stellt synthetischer Knochenersatz dar, der aber mechanisch oft nur wenig belastbar sowie durch dauerhafte Störungen der Bildgebung ungünstig ist. Als ideale Alternative gelten daher degradierbare Werkstoffe, also solche Implantate, die nach erfolgter Heilung verschwinden – so wie das Magnesiumimplantat des Fraunhofer IFAM Dresden.
Ausgangspunkt der technologischen Entwicklung ist die Fertigung von Magnesium-Kurzfasern durch Extraktion aus der Schmelze. Die Fasern werden dann gleichmäßig abgelegt sowie durch Erwärmung miteinander verbunden und verdichtet. Die so hergestellten Implantate besitzen sehr gute mechanische Eigenschaften und vor allem Korrosionseigenschaften, die den physiologischen Anforderungen besonders gerecht werden. Im Tiermodell konnte damit nach 12 Wochen eine zunächst langsame Korrosion festgestellt werden, nach 24 Wochen war der Großteil der metallischen Implantate dann verschwunden. in der Oral-Chirurgie und evaluiert derzeit den Aufbau einer geeigneten Fertigungskette. (me)
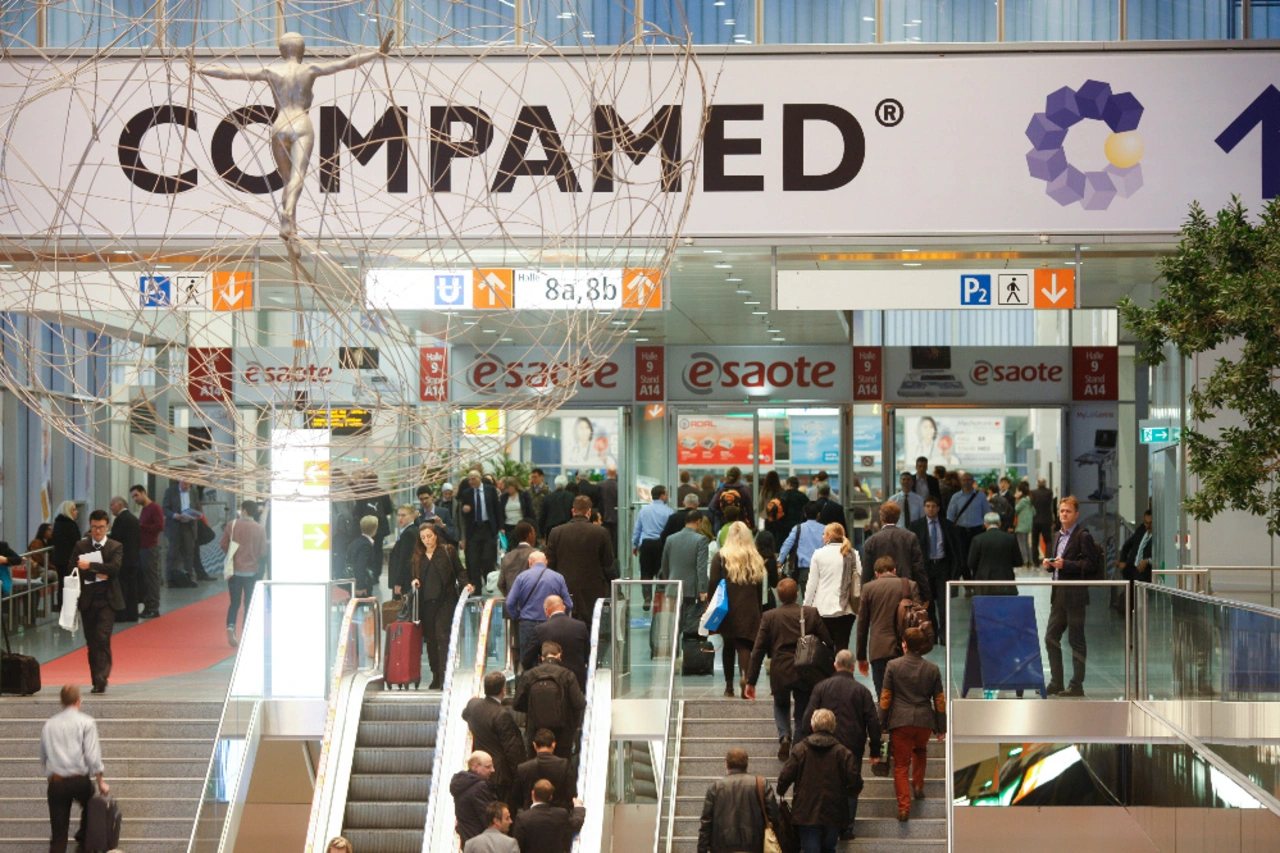
- »Implantate in der Medizintechnik«
- Aktive Implantate für personalisierte Neuroprothetik