Sichere Handhabungskonzepte für Medizingeräte
Fehlbedienung ausgeschlossen
Wie gelingt es, Medizinprodukte trotz ständig steigender Komplexität benutzungsfreundlich zu gestalten und so das Risiko für Bedienfehler zu reduzieren? Mit einem benutzerzentrierten Gestaltungsprozess, der von Anfang an den Nutzer und seine Anforderungen berücksichtigt. Usability (Gebrauchstauglichkeit) in die Entwicklung einzubeziehen führt zu einfach bedienbaren und damit auch sichereren Produkten – ein enormer Marktvorteil für Hersteller von Medizinprodukten.
Laut den Normen DIN EN 60601-1-6 und DIN EN 62366 müssen Hersteller von Medizinprodukten einen »Usability Engineering Process« durchführen und in einem »Usability Engineering File« (UEF) dokumentieren. Beide Normen sind somit relevante Zulassungsvoraussetzungen für Medizinprodukte.
Die DIN EN 60601-1-6 gilt für elektrische Medizingeräte. Die Norm DIN EN 62366 fordert einen Ergonomie-Prozess für alle Medizinprodukte. Sie ist somit auch für Hersteller von In-vitro-Diagnostika, medizinischer Software oder Implantaten Pflicht.
In den vergangenen Jahren ging der Trend bei Labor- und Medizingeräten zu eingebetteten Systemen, die beispielsweise eine Insulinpumpe steuern oder Physiotherapeuten bei der Rehabilitation unterstützen. Im Kontext der regulatorischen Anforderungen ist dies eine neue Herausforderung in Entwicklung und Gestaltung von Benutzerschnittstellen.
Während ein Herzschrittmacher zum Beispiel ohne unser Zutun funktioniert, sollten Hersteller bei vielen anderen Produkten Tasten und Bildschirmanzeigen so gestalten, dass Anwendungs- und Bedienrisiken minimiert werden. Gleichzeitig müssen die Nutzer dieser Produkte mit immer mehr und immer komplexeren Informationen und Funktionen umgehen.
Sichere Handhabung istfür Medizingeräte Pflicht
Gelingt es uns bei bestimmten Produkten überhaupt noch, alle Funktionen zu kennen und zu durchschauen? Lautet die Antwort »Nein«, dann ist es um die »Usability« (Gebrauchstauglichkeit) meist schlecht bestellt. Dabei müssen gerade medizinische Geräte nicht nur technisch, sondern auch in der Handhabung sicher gestaltet sein.
Egal ob beim Einsatz in kritischen Situationen und unter Zeitdruck oder bei der Bedienung durch unerfahrene Nutzer – bei Medizinprodukten sind das Risiko für Bedienfehler groß und die Folgen für den Patienten zum Teil lebensbedrohlich.
Dies ist eine große Herausforderung bei der Gestaltung von Medizinprodukten, denn die Rahmenbedingungen für Entwickler sind anspruchsvoll: kleine Displays sowie begrenzte Speicherkapazität und Prozessorleistung.
Trotzdem sind die Möglichkeiten der Produktgestaltung aktuell so spannend wie nie zuvor: Leistungsfähige Grafikdisplays, flache Sensortasten, kapazitive Touchscreens, »intelligente« Umfeldsensoren und viele weitere technische Entwicklungen erlauben neue Wege im Produkt- und Interaktionsdesign. Mit der Zahl der Möglichkeiten steigt der Bedarf nach einem systematischen Vorgehen bei der Gestaltung.
Jobangebote+ passend zum Thema
Bedienkonzept systematisch gestalten
Herausragende Bedienkonzepte entstehen nur durch einen klar strukturierten Gestaltungsprozess, der die Benutzer systematisch und konsequent einbindet. Einen entsprechenden Prozess beschreibt die DIN EN ISO 9241-210 (Norm für den »Prozess zur Entwicklung gebrauchstauglicher Systeme«, ehemals DIN EN ISO 13407). Sie verzeichnet Regeln für die benutzerorientierte Gestaltung interaktiver Systeme und empfiehlt Herstellern vier Phasen:
- Analysieren: In der Analyse werden Informationen gesammelt über die Benutzer, deren individuelle Bedürfnisse, Aufgaben und Ziele sowie die typische Nutzungsumgebung. Usability-Experten definieren Anforderungen an das spätere Produkt. Zum Einsatz kommen Methoden wie Vor-Ort-Studien, Interviews und Fokusgruppen. Es entstehen typische Nutzungsszenarien, auch »User Stories« oder »Use Scenarios« genannt.
- Gestalten: In dieser Phase entwerfen User-Interface-Spezialisten schrittweise Informationsarchitektur, Navigations- und Interaktionskonzept sowie Layout und Design der Bedienung. Auch hier werden verschiedene Methoden wie Gestaltungs- oder Kreativ-Workshops, Papier-Prototypen, »Wireframes« und Kreativitätstechnik eingesetzt.
- Erfahrbar machen: Eine frühzeitige Visualisierung und ein Prototyp machen die Interaktions- und Designkonzepte erfahrbar. Dabei kommen unterschiedliche Arten von Prototypen zum Einsatz – vom einfachen Papier-Prototypen bis hin zum interaktiven Prototypen mit realer Hard- und Software.
- Testen: Bei der Evaluation überprüfen Usability-Experten kontinuierlich, inwieweit die vorliegenden Interaktions- und Designkonzepte den zuvor definierten Anforderungen genügen.
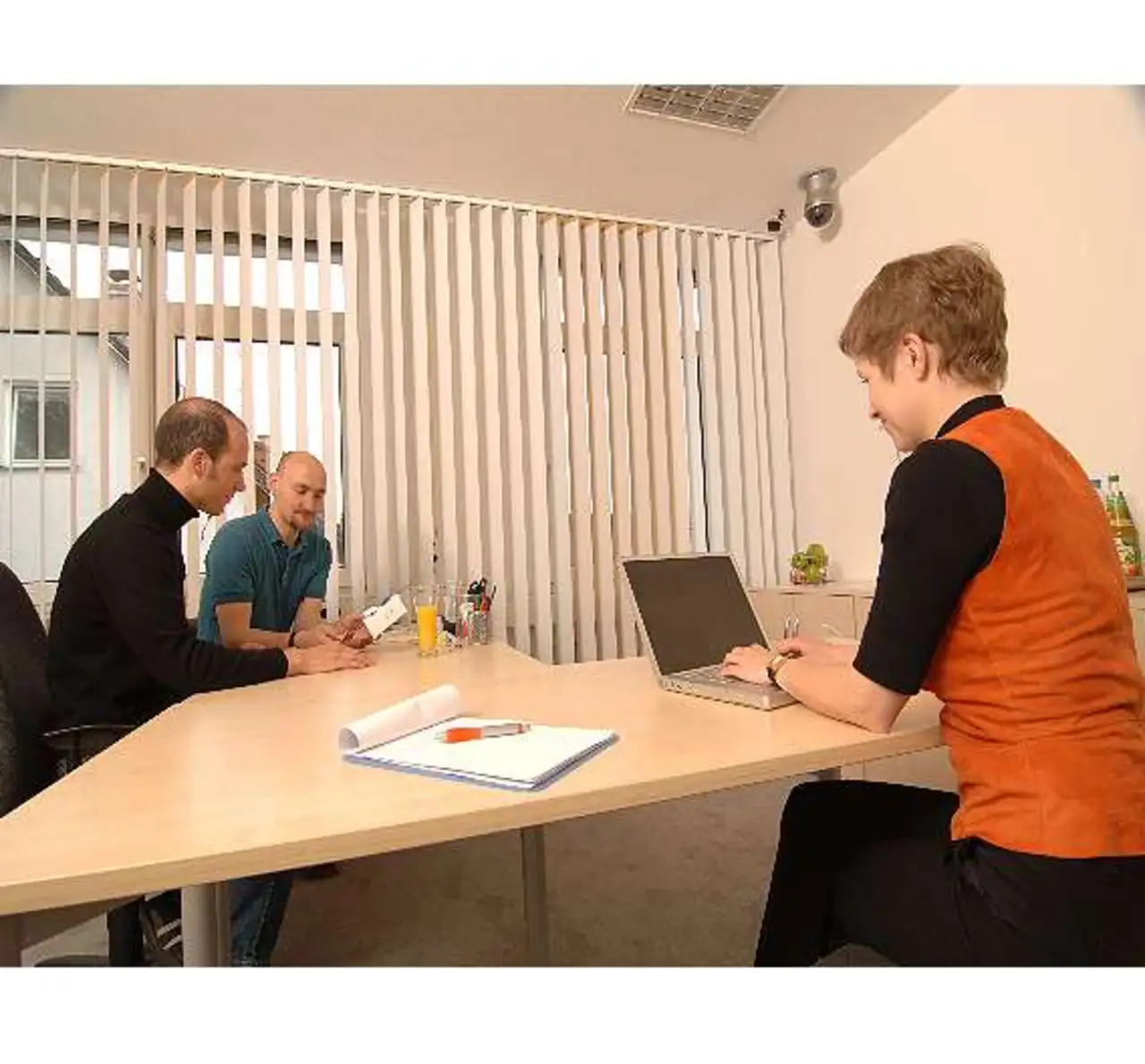
Mittels Usability-Studien wird die Gebrauchstauglichkeit des Prototyps getestet.
Dabei bearbeiten die Teilnehmer typische Aufgaben mit einem interaktiven Produkt oder einem Prototyp (Bild 1).
Usability-Experten analysieren, wo Nutzungsprobleme auftreten und identifizieren mögliche Ursachen sowie individuell wahrgenommene Stärken und Schwächen des Produkts.
Die einzelnen Aktivitäten des benutzerzentrierten Gestaltungsprozesses lassen sich in verschiedene Entwicklungsprozesse wie V-Modell, Spiralmodell, aber auch agile Entwicklungsmethoden integrieren.
Benutzerzentrierte Gestaltung in der Praxis
Wie diese Anforderungen in die Praxis umgesetzt und gleichzeitig ein Produkt mit optimaler Bedienbarkeit gestaltet werden kann, zeigt das Beispiel eines Geräts für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) von Olympus. Das Produkt ist ein innovatives System zur Vervielfältigung von Gensequenzen aus kleinsten Mengen DNA.
Typische Einsatzgebiete sind die Kriminaltechnik (Spurenanalyse), Krebsforschung und die Pränataldiagnostik. Dabei wird DNA auf unterschiedliche Temperaturstufen erhitzt. Das Geheimnis der Vervielfältigung liegt also in der kontrollierten Abfolge bestimmter Temperaturen.
- Fehlbedienung ausgeschlossen
- Fehlbedienung ausgeschlossen