»Data Driven Decision Making« im IIoT
Mit der Datenerfassung fängt's erst an
Fortsetzung des Artikels von Teil 1
Schlechte Vergleichbarkeit von Software-Tools
Gleichzeitig empfiehlt es sich, das IIoT-Projekt langfristig zu denken und eine Strategie rund um die zu erfassenden und auszuwertenden Daten zu definieren. Sinnvoll sind vor allem Fragen zum Ist-Zustand: Welche Daten werden bereits erfasst, wie und von wem werden sie genutzt? Hinzu kommen Betrachtungen zum eigentlichen Ziel und zur Umsetzung der IIoT-Initiative: Handelt es sich eher um eine Produkterweiterung oder um ein ganz neues Geschäftsmodell? Welche Erkenntnisse sollen aus den Daten gewonnen, welche Prozesse angestoßen werden? Aus welchen weiteren Quellen sind möglicherweise Daten einzuspeisen?
Eine Lösung selbst zu entwickeln ist kaum sinnvoll
Für all diese Zwecke eine IoT-Plattform in Eigenregie zu entwickeln ist zeitaufwändig und nicht zu empfehlen. Es fehlen schlichtweg ausreichende Entwicklerkapazitäten und angestammte IT-Expertise. In den meisten praktischen Fällen in der Industrie geht es stattdessen um konkrete Use Cases, die sich mit individuell modifizierten Lösungen externer Anbieter umsetzen lassen.
Das Problem ist das große Angebot von Software Tools, die sich wegen unterschiedlicher Ansätze und völlig verschiedener Funktionen kaum miteinander vergleichen lassen. Auch hier ist Vorsicht geboten. Statt einer vermeintlichen One-Size-Fits-All-Lösung, die von großen generalistischen Anbietern versprochen wird, lohnt sich die Suche nach einem auf die Branche spezialisierten Nischenanbieter für den Mittelstand oft mehr. Denn die Bedingungen in mittelständischen Unternehmen und entsprechende Ansprüche an die Lösung sind oft speziell.
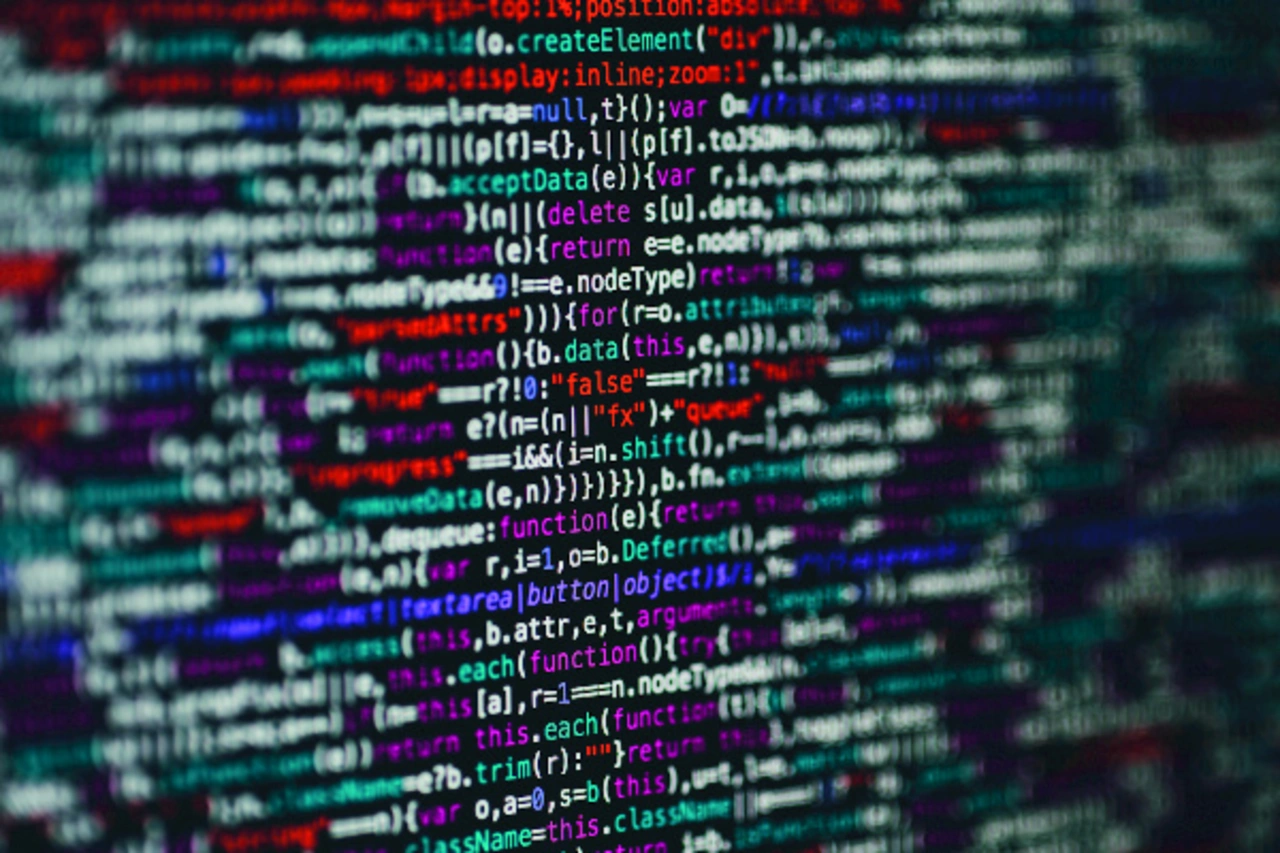
Weil eine IIoT-Lösung in bestehende Maschinen- und Anlagenumgebungen integriert werden muss, sollte sie offene und flexible Schnittstellen bieten. Denn es müssen verschiedenste Daten und Protokolle ausgelesen werden – von SPSen, die fast jeder Hersteller heterogen definiert, über Betriebsdatenspeicher wie SQL-Datenbanken und Logfiles bis hin zu TCP-Socket-Schnittstellen und REST-APIs.
Jede Datenquelle spricht eine andere Sprache. Dabei liegen die Maschinendaten häufig in sehr kryptischen, teils jahrzehntealten Spezialformaten vor – sie sind schlicht nicht für die Vernetzung mit anderen Geräten ausgelegt. Hinzu kommen die Daten zusätzlich integrierter Sensoren, mobiler Endgeräte oder gar ganz anderer Quellen, etwa zugekaufte Geo-Daten oder Wetterprognosen.
Eine IIoT-Lösung muss in der Lage sein, diese verschiedenen Formate zu normalisieren und so zu übersetzen, dass sie sich miteinander in Relationen bringen und eben nicht nur für Daten-Analysten, sondern auch für alle anderen Nutzer interpretieren lassen. Deshalb sollte sie Funktionen und Möglichkeiten bieten, die Daten für Mitarbeiter praktisch nutzbar zu machen. So gibt es beispielsweise IIoT-Techniken wie die Lösung von Senseforce, mit der sich Nutzer ihr grafisches Interface per Drag and Drop selbst zusammenstellen können. Für solche Low-Code-Entwicklungsumgebungen sind keine besonderen Programmierkenntnisse erforderlich.
Die Datenerfassung ist bei einem IIoT-Projekt nur ein Teil des Ganzen. Mindestens ebenso wichtig ist es, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, was die Daten strategisch für das Geschäft heute und in Zukunft bedeuten. Außerdem sollten gerade mittelständische Industrieunternehmen sorgfältig abwägen, welche IIoT-Plattform das eigene Projekt am besten unterstützt. Angebote großer IoT-Dienstleister sind oft zu starr und zu wenig an die speziellen Bedürfnisse der Branche anpassbar.
Interoperabilität und Offenheit gegenüber anderen Systemen sind ein Muss. Entscheidend aber ist, dass die Mitarbeiter mit einer IIoT-Lösung wirklich umgehen und sie problemspezifisch modifizieren können. Nicht die erfassten Daten und vorgegebene Analysen bestimmen, sondern das fachspezifische Ziel hinter dem IIoT-Projekt. Auch für die Akzeptanz der Lösung ist das entscheidend. Wird der Mehrwert für die Fachabteilungen nicht klar, bleiben die Steigerung der Produktivität und die Innovationskraft auf der Strecke. Nur mit einem intuitiven Werkzeug können Entscheidungen wirklich auf Daten beruhen.
Michael Breidenbrücker ist Gründer und CEO von Senseforce.
- Mit der Datenerfassung fängt's erst an
- Schlechte Vergleichbarkeit von Software-Tools


