Forschungszentrum Jülich
Optische Datenübertragung auf Chip-Level - Stand der Technik
Fortsetzung des Artikels von Teil 2
Optische Datenübertragung: Technische Anforderungen
Elektronik: Mit der von Ihrer Forschungsgruppe entwickelten SiGeSn-Diode lässt sich Licht mit einer Wellenlänge zwischen 2 und 2,6 Mikrometern erzeugen. Ist das auch der Wellenlängenbereich, den die Industrie zur optischen Datenübertragung zwischen Computerchips nutzen möchte?
Prof. Dr. Grützmacher: Die Angabe der 2–2,6 µm Wellenlänge bezieht sich auf den Betrieb bei tiefen Temperaturen; bei Raumtemperaturen sind die Wellenlängen eher etwas länger, bis etwa 3,5 µm.
Für die angedachten Anwendungen der optischen Datenübertragung zum und zwischen Boards, bis zum Chip sowie zwischen unterschiedlichen Cores innerhalb des Chips und eventuell bis zum Chip-Level, zum Beispiel für die Synchronisation des Rechnens (Optical Clock Distribution), sprechen wir von kurzen Wegen im Bereich von Metern bis Zentimetern; hier ist die Wellenlänge nicht so entscheidend. Wichtig ist die notwendige Bandbreite und in dieser Hinsicht bieten optische Leiter gegenüber herkömmlichen Kupferleitungen deutliche Vorteile. Bei Datenraten von mehr als 50 Gbit/s ist beispielsweise die optische Datenübertragung der effizientere und kostengünstigere Weg bis zu einer Leitungslänge von 2 m.
Bei noch höheren Datenraten überwiegen die Vorteile schon bei kürzeren Längen. Welche Technologie schlussendlich eingesetzt wird, entscheidet neben der Leistungs- auch die Kostenfrage. Eine Silizium-basierte Technologie erscheint aus Kostengründen hier sehr attraktiv.
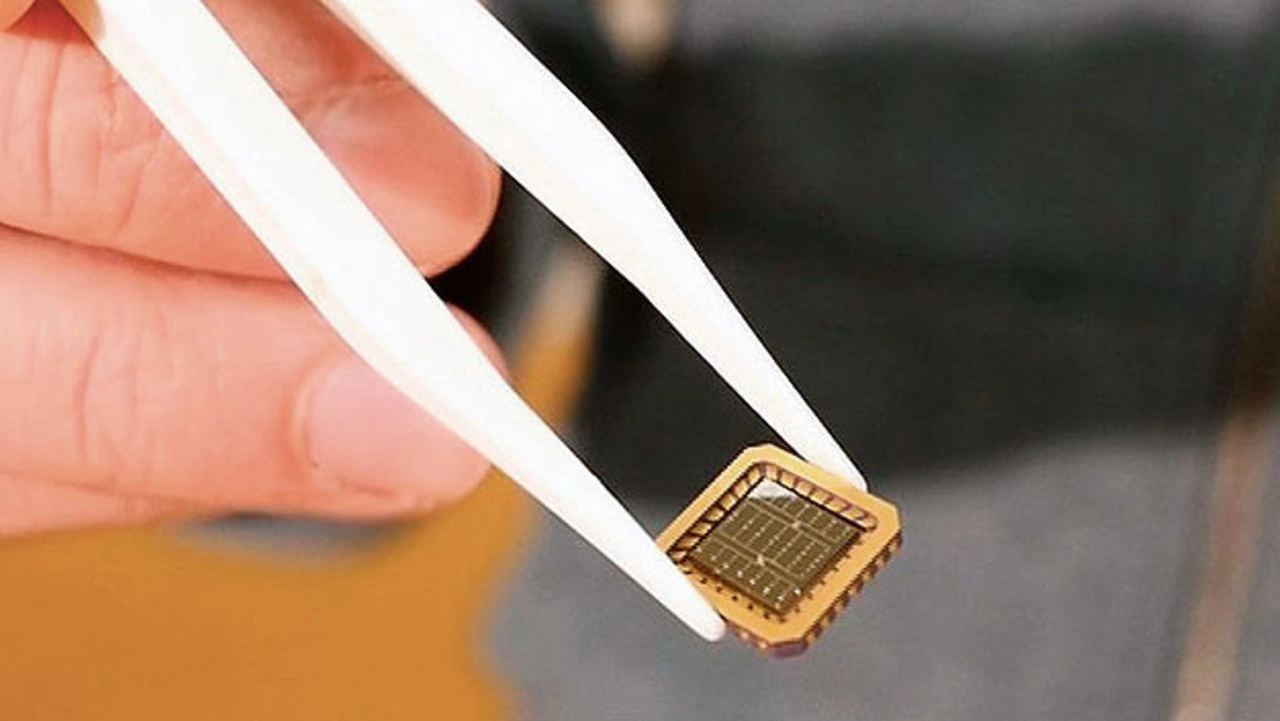
Elektronik: Auf Chip-Ebene steht für die optische Datenübertragung nur wenig elektrische Leistung zur Verfügung, mit der ein gewisses Mindestmaß an Lichtintensität erzeugt werden muss. Wo stehen Sie in dieser Beziehung aktuell?
Prof. Dr. Grützmacher: Für die optische Datenübertragung mit sehr hohen Datenraten braucht man einen elektrisch gepumpten Laser; dieser steht derzeit noch nicht zur Verfügung. Wir stehen hier also ganz am Anfang und können jetzt nur schwer abschätzen, wie weit uns diese GeSn/SiGeSn-Technologie trägt.
Elektronik: Worin sehen Sie die größten Vorteile, wenn Computerchips ihre Daten nicht mehr elektrisch, sondern optisch übertragen?
Prof. Dr. Grützmacher: In einem Rechner entsteht der Großteil der Verlustleistung in den Widerständen von Kupferleitungen. Würden sie durch Lichtleiter ersetzt, könnte sehr viel elektrische Energie eingespart werden. Zum Beispiel verbraucht alleine die Synchronisation mittels Kupferleitungen etwa 30 % der Energie eines Silizium-Chips. Aber auch für die Datenübertragung zwischen Chips, zwischen Logik und Speicher-Bauteilen muss sehr viel elektrische Energie aufgewendet werden, die sich mit Hilfe von Lichtleitern einsparen lässt. Hinzu kommt die limitierte Bandbreite von Kupferleitungen, welche bereits heute ein wachsendes Problem in modernen Computerarchitekturen ist.
In zukünftigen Computersystemen, die mit hohen Datenraten massiv parallel rechnen, wird der Einsatz von Lichtleitern zur Notwendigkeit. Natürlich muss für den oder die Laser Energie fürs elektrische Pumpen aufgewendet werden. Hier sind sicherlich solche mit hoher Energieausbeute gefragt.
Elektronik: Wie würde dazu der Aufbau der Chips verändert werden müssen? Und sehen Sie Schwierigkeiten bei der Wärmeableitung, wenn Kupferleiterbahnen durch optische Pfade ersetzt werden?
Prof. Dr. Grützmacher: Zunächst ist natürlich die Meinung, dass der Wärmeeintrag mit dem Ersatz von Kupferleitungen durch Lichtleiter erheblich reduziert wird. Probleme mit der Wärmeableitung sollten daher nicht auftreten.
Natürlich wird man nicht alle Kupferleitungen in einem Chip ersetzen können. Ein Transistor schaltet elektrischen Strom und es macht keinen Sinn, vor jeden Transistor ein Element zu setzen, welches Licht in ein elektrisches Signal umsetzt. Das wäre auch nicht energieeffizient. Vorstellbar wäre es zum Beispiel, dass man mehrere Silizium-Bausteine auf eine optische Lichtleiterplatte setzt, einen optischen Interposer, der eine wesentlich höhere Packungsdichte und Bandbreite ermöglicht als Kupferleitungen. Dieser würde zusammen mit einem Photonic Chip die optische Datenübertragung zwischen den Bauteilen und der restlichen Umgebung organisieren.
- Optische Datenübertragung auf Chip-Level - Stand der Technik
- Interview: Aktueller Forschungsstand
- Optische Datenübertragung: Technische Anforderungen
- Nächste Schritte und Zeithorizont