Eine wie alle
Geregelte RGBW-LEDs im Wireless-Netzwerk
Fortsetzung des Artikels von Teil 1
Unterschiede bei Lichtfarben
Lichtfarbe und Lichtstrom einer LED sind abhängig von der Alterung, dem Durchlassstrom sowie der Temperatur der LED, die sich im Betrieb je nach LED-Typen spezifisch verändern kann. Dazu kommen möglicherweise spektrale Abweichungen, wenn sich auf Basis von Beanspruchungen oder Umgebungsbedingungen die Primäroptik, der LED-Leuchtstoff oder auch der LED-Die verändern, was zu individuellen Farbfehlern der einzelnen LEDs führt.
Durch mechanische Beanspruchung, Trübung, Umwelteinflüsse, Feuchtigkeit, Temperatur, chemischen Fluss und elektrostatische Entladungen kann es bei der Herstellung der LEDs aber auch während des Betriebs über die Lebenszeit zu Drift und Delamination kommen. Die Helligkeit von LEDs aus derselben Charge kann um bis zu 20 % variieren und die dominanten Wellenlängen von LEDs desselben Typs können um bis zu ±8 nm streuen. Das Farbort-Binning laut Datenblatt der LED-Hersteller bezieht sich auf die LED an sich und ist damit für die Applikation im System des Anwenders nur bedingt aussagekräftig.
Individuelle Farb-Shifts der LEDs durch Temperaturwechsel, Alterung oder Dimmung mit spektralen und sichtbaren Verschiebungen sind hinlänglich bekannt und von Anbieter zu Anbieter sowie von LED-Typ zu LED-Typ verschieden. In Summe tragen alle diese Faktoren zu Farbdifferenzen im Betrieb der LEDs bei, die für das menschliche Auge sichtbar sind und je nach Applikation als störend empfunden werden können. In farb- und helligkeitsunkritischen Anwendungen kommt es zu keinen Beeinträchtigungen durch diese Effekte.
Anders ist es jedoch, wenn Farbort und Helligkeit in der Applikation statisch oder als Szenario definiert sind und das menschliche Auge deshalb Abweichungen aufnimmt und erkennt. Durch neue Qualitätsstandards und aktuelle designtechnische Erwartungen wird die Farbstabilität immer wichtiger. Solche Anforderungen an die Farbechtheit verlangen nach einer Konstanz über die gesamte Lebenszeit, ohne dass sichtbare Differenzen pro Lichtpunkt über die Betriebsdauer oder zeitgleich als Lichtzeile bzw. -fläche auftreten. Beleuchtungsentwickler können auf verschiedene Methoden zurückgreifen, um diese Anforderungen zu erreichen.
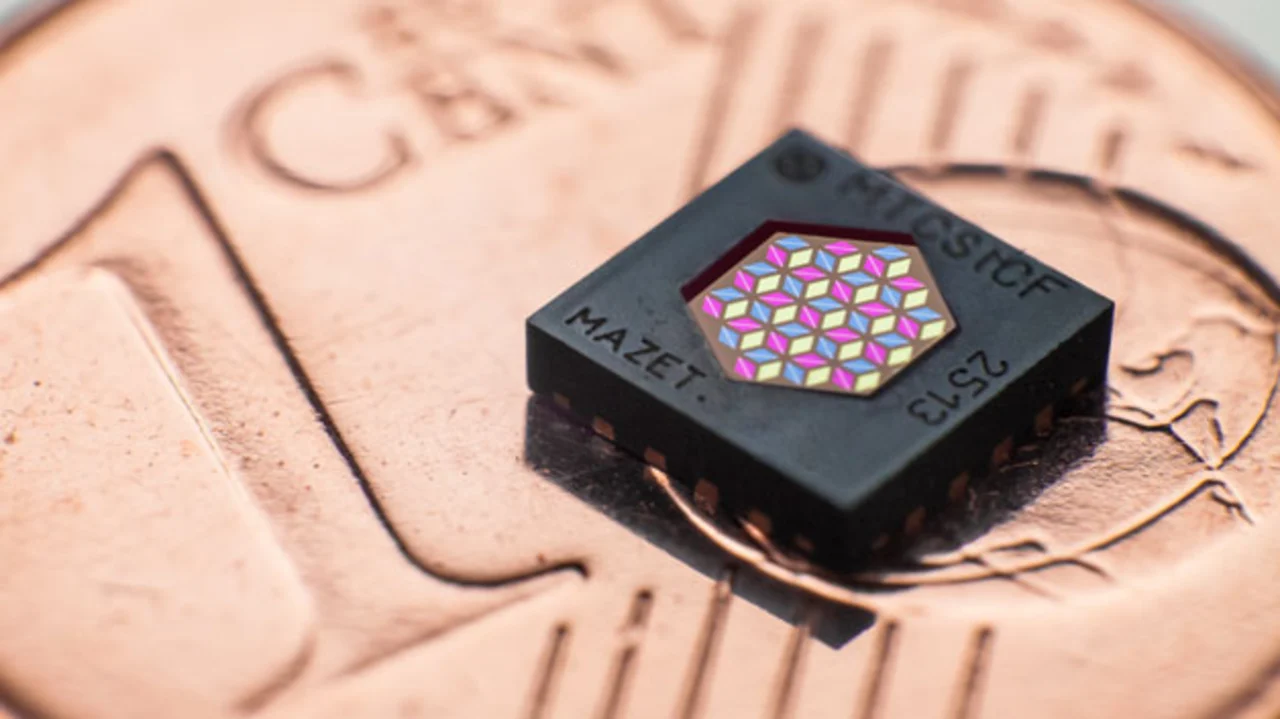
Verfahren zur LED-Regelung
Die Tabelle zeigt übliche Verfahren zur Steuerung und Regelung von LEDs zum spektralen Drift-Ausgleich, welche sich in Aufwand und Wirkung stark unterscheiden. Die Regelung über Strom und Temperatur kann über A-priori-Wissen erfolgen. In Voruntersuchungen werden auf Basis einzelner Muster das typische Verhalten im Drift als Funktion des Stroms und der Temperatur erfasst, inter- bzw. extrapoliert und diese Werte als Steuerfunktion in der Applikation für alle LEDs verwendet.
Das bedeutet, dass man von einzelnen, beispielhaften Musterkomponenten auf alle Serienelemente schließt. Toleranzen der einzelnen LEDs sowie systembedingte Abweichungen bleiben unberücksichtigt, genau wie auftretende lichttechnische Störungen aus dem Umfeld. Die Regelung über die Helligkeit mittels einzelner Dioden basiert auf der Messung der Störungen. Allerdings lassen sich spektrale Einflüsse ohne Auswirkungen auf die Helligkeit nicht oder nur unvollständig steuern.
- Geregelte RGBW-LEDs im Wireless-Netzwerk
- Unterschiede bei Lichtfarben
- Farb-Drifts feststellen