Sicherheitselais mit zwangsgeführten Kontakten
Kein Zacken aus der Krone
Fortsetzung des Artikels von Teil 2
Kein Zacken aus der Krone
Kritisch sind hierbei weniger hohe Schaltlasten (diese reinigen die Kontaktoberfläche zumeist durch den Lichtbogen) als niedrige Schaltlasten. Denn die Kontakte dieser Relais sind weder evakuiert, in Glas eingegossen (wie z.B. bei Reedrelais) noch durch Schutzgasflutung vor Umwelteinflüssen besonders geschützt.
Trotz aller Schutzmaßnahmen wie z.B. Vergießen handelt es sich um relativ offene Konstruktionen, bei denen die Kontakte durch die Diffusion von Schadgasen und Wasser über das Gehäuse geschädigt werden können. Hinzu kommt, dass die Kontaktniete zwar so sauber wie möglich hergestelllt und verarbeitet werden, aber eine minimale, zumeist organische Belegung nicht zu verhindern ist.
Jobangebote+ passend zum Thema
Der im Neuzustand sehr niedrige Kontaktwiderstand von wenigen mΩ kann über die Betriebsdauer durch Schaddstoffe und den Abrieb des Kontaktmaterials stark ansteigen – bis hin zur Isolation. Die oberen Lastgrenzen werden durch die maximale Leistungsfähigkeit des Kontakts definiert. Grundsätzlich sind oberhalb der Lichtbogen-Grenzspannung (bei Silberwerkstoffen ca. 28 V) stabile Lichtbögen und damit ein gutes Reinigen der Kontaktoberfläche zu erwarten. Im Bereich der »Short Arcs« (300 mV bis 10 V und 10 mA bis 100 mA) und bei den »Low Level Loads« (100 mV bis 300mV und bis 10 mA) wird es jedoch immer kritischer. Bei diesen Lasten ist die elektrische Reinigung der Kontakte teilweise kaum noch gegeben. Lasten unterhalb der »Low-Level-Loads« werden als »Dry Load« oder Trockenlasten bezeichnet. Diese sind von Relais mit zwangsgeführten Kontakten über lange Zeiträume kaum noch stabil zu schalten.
Um gerade bei Anwendungen mit geringen Schaltlastten die Schaltzuverlässigkeit zu erhöhen, versuchen die Relaishersteller die negativen Auswirkungen der oben beschriebenen Alterungseffekte zu minimieren. Dabei sind neben dem Kontaktmaterial und der Oberflächenveredelung und -güte vor allem die Relaiskonstruktion und die Kontaktform von Bedeutung. Bei der Relaiskonstruktion erzielen die Entwickler in erster Linie durch die geschickte Auslegung des Magnetsystems eine möglichst große Kontaktkraft. Für die Reinigung der Kontaktflächen spielt die Relativbewegung der Kontaktstücke zueinander eine große Rolle, daher sind die Relaiskontakte mechanisch so aufgebaut, dass sie beim Schließ- und Öffnungsvorgang eine Reibbewegung ausführen. Dabei ist die Weglänge dieser Reibbewegung wichtig, sie muss lang genug sein, um die abgeriebenen Verschmutzungen aus der Kontaktbahn herauszubefördern.
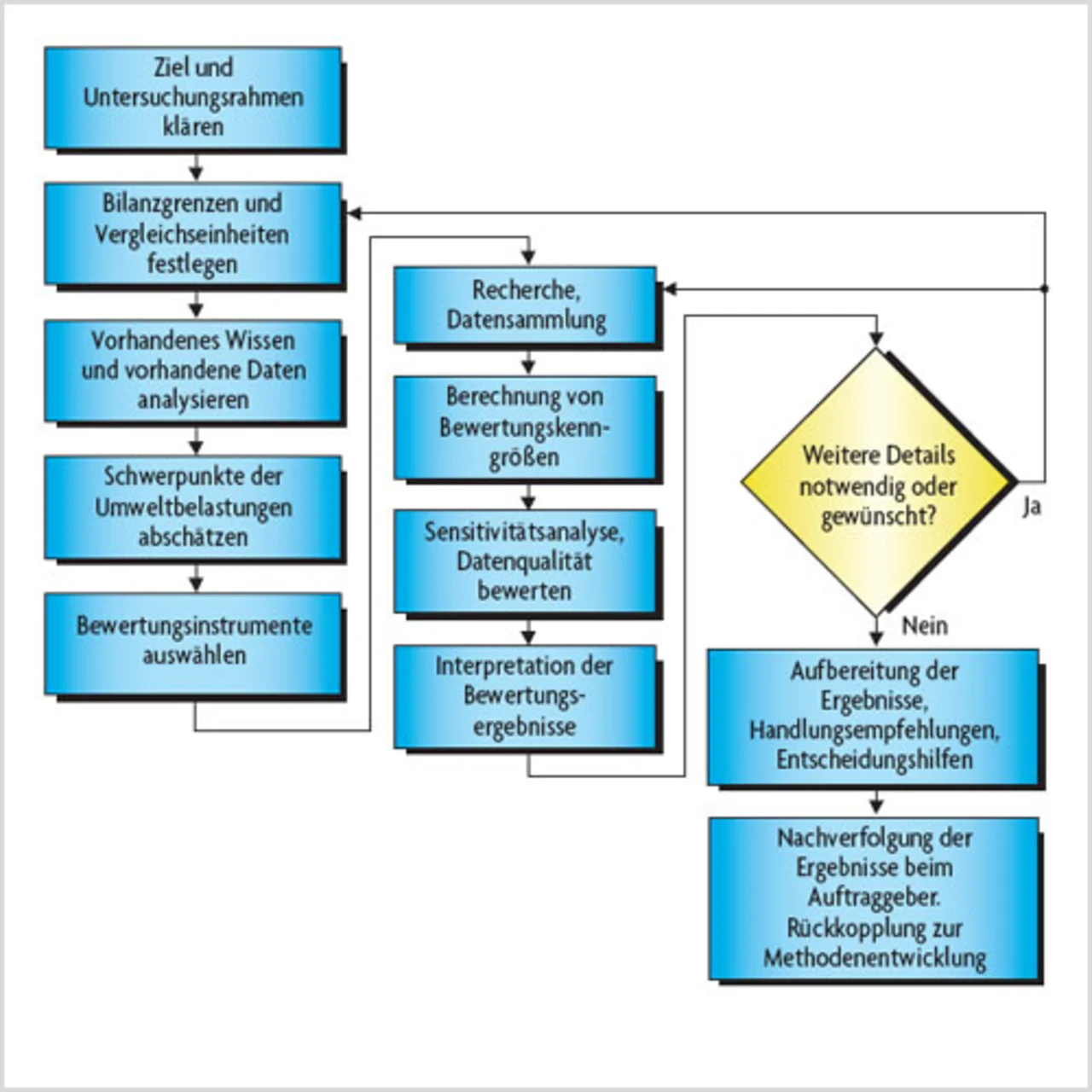
Einer der wichtigsten Faktoren für die Zuverlässigkeit von Relais ist die Form der Kontakte (Bild 1). Am weitesten verbreitet ist der Einfachkontakt, er weist gleich bleibend stabile Kontaktkräfte auf, hat jedoch nur eine mögliche Kontaktstelle. Rechnerisch lässt sich nachweisen, dass zwei Kontaktpunkte die Kontaktsicherheit verzehnfachen. Daher kommen oft Doppelkontakte zum Einsatz, die jedoch durch die geteilte Feder den Nachteil einer geringeren Kontaktkraft pro Kontakt aufweisen. Beim Kronenkontakt sind die Kontaktflächen nach innen gewölbt und leicht versetzt zueinander positioniert. Dadurch ergeben sich zwei Kontaktstellen an den Rändern bei gleich bleibend hoher Kontaktkraft.
- Kein Zacken aus der Krone
- Kein Zacken aus der Krone
- Kein Zacken aus der Krone