Kabellose Zukunft?
Fortsetzung des Artikels von Teil 1
Die systematische Produktentwicklung
Grundlage ist eine Quality- Function-Deployment-Analyse, kurz QFD, wie sie sich in der Industrie zur Definition von Produkten bewährt hat, die sich an tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden orientieren. Die ursprünglich in Japan entwickelte Methode wurde in den 8Oer Jahren in der US-amerikanischen Automobilindustrie eingeführt und wird mittlerweile auch in Europa zunehmend im Rahmen der Qualitätsplanung eingesetzt. Die Methode dient der systematischen Planung der Qualität eines Zielproduktes, ausgehend von kunden- und marktseitigen Qualitätsanforderungen. Ergänzend werden Anforderungen an die notwendigen Produktionsprozesse und Qualitätssicherungsmaßnahmen zur Herstellung des Zielproduktes abgeleitet. Die Maxime des QFD lautet, dass bei qualitätsrelevanten Entscheidungen der Stimme des Kunden immer Vorrang einzuräumen ist. Wegen dieses umfassenden Ansatzes ist die Mitwirkung der verschiedenen betroffenen Unternehmensbereiche im Rahmen von Arbeitsgruppen eine unabdingbare Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz des Quality Function Deployment. Dies gilt in besonderem Maße für bereichsübergreifende Umsetzung der Anforderungen. Nur durch Kooperation traditionell separater Arbeitsbereiche lässt sich die notwendige Akzeptanz gegenüber den Planungsergebnissen erzielen.
Im EnAS-Projekt wurden die QFD-Kriterien in einer Online-Befragung ermittelt und anschließend hinsichtlich ihrer Wichtigkeit eingestuft. In den ersten Monaten des Projektes wurden mehr als 30 Personen befragt, die hauptsächlich zum Vertrieb oder zu den potenziellen Anwendern der Technologie gehören. Die aus den Kundenbedürfnissen abgeleiteten Qualitätsmerkmale
- hohe EMV-Verträglichkeit,
- leicht verständliche Dokumentation,
- möglichst Nutzung offener Standards,
- offenes, flexibles Sensorkonzept,
- gute Struktur in der Produktinformation,
- einfache und vielfältige Planungshilfen,
- hohe Skalierbarkeit,
- mechanische Robustheit und
- hohe Lebensdauer
sind nicht nur Entwicklungsvorgaben. Insbesondere die EMV-Verträglichkeit und der Wunsch nach gute Dokumentation und Planungshilfen spiegeln auch eine gewisse Skepsis gegenüber der drahtlosen Kommunikation wider. Aus dieser Skepsis resultiert die wichtige Aufgabe, im EnAS-Projekt begleitende Aktivitäten zu definieren, die die Vorbehalte bei den Anwendern aufgreifen und entkräften. Neben einer hohen Robustheit und Zuverlässigkeit ist also auch auf einfache Handhabung zu achten. Eindrückliche Pilotapplikationen können ebenfalls die Akzeptanz verbessern.
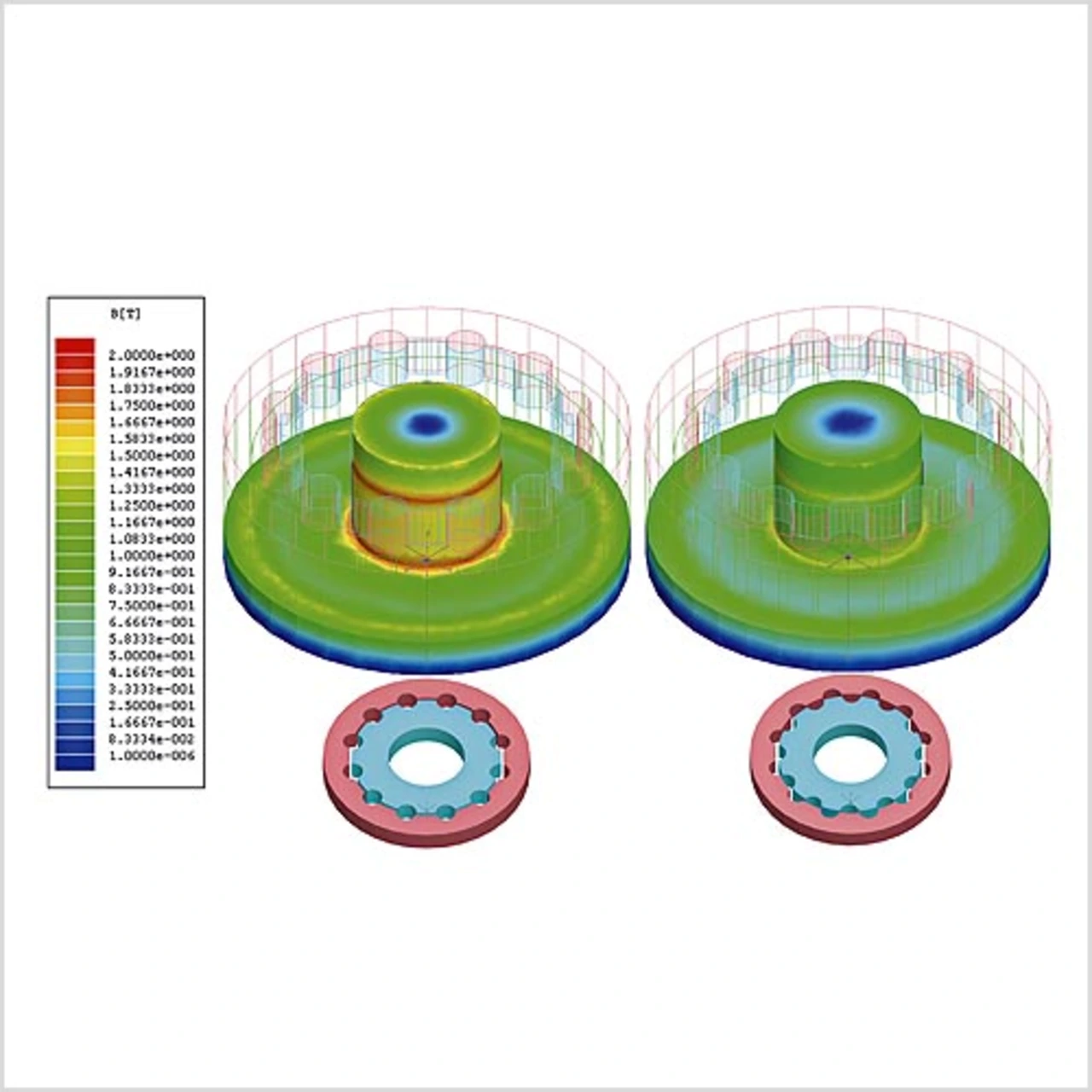
Echtzeit versus Reichweite
Die Auswertung der Anforderungen bezüglich Reichweite, Zeitverhalten und Datendurchsatz hat gezeigt, dass ein neues Funkkonzept allein nicht in der Lage ist, die teilweise diametral auseinander liegenden Forderungen zu erfüllen. So korrespondiert die für Fertigungsanlagen geforderte Echtzeit-Reaktion nicht mit der Forderung nach Reichweite. Aus diesem Grund verfolgt das Entwicklungsteam zwei Lösungen: Die eine zielt auf die Realisierung von Echtzeit- Anforderungen, die andere ist auf das Erzielen größerer Reichweiten angelegt. Hier bietet sich ein Rückgriff auf die VDI-Richtlinie 2185 an, die Merkmale zur Unterscheidung der Anwendungsklassen liefert: Demnach ist für die Ausprägung "Echtzeit" bei einer Reichweite von 10 m ein Datendurchsatz von 100 Teilnehmern in 5 ms vorgegeben, für die Ausprägung "Reichweite" liegt der Datendurchsatz bei einer Reichweite von 100 m für fünf Teilnehmer bei 100 ms.
Generell werden komplexe Produktionsanlagen in kleinere, selbstständige Fertigungszellen untergliedert. Daher ist es erforderlich, das zu entwerfende drahtlose Sensor/Aktor-Netzwerk (WSAN) reibungslos in die gegebenen Strukturen der Fabrikautomatisierung einzubetten. Somit sollte das WSAN zellular strukturiert werden. Ergo wird pro Subprozess beziehungsweise Produktionszelle ein WSAN eingesetzt, so dass mehrere WSANs in gegenseitiger Funkreichweite koexistieren. Um eine Reduzierung frequenzselektiver Störungen zu erreichen, hat sich eine Kombination von Frequeny Domain Multiple Access (FDMA) und Time Domain Multiple Access (TDMA) bewährt.
Neben einer Strukturierung in mehrere zeitliche Abschnitte wird auch auf unterschiedliche Frequenzen zugegriffen. Hierdurch entstehen zwei Freiheitsgrade: Einerseits gewährleisten sie die benötigte Bandbreite für jeden Teilnehmer; andererseits ist die Verzögerung der einzelnen Teilnehmerdaten deterministisch und lässt sich mit Hilfe von Worst-Case-Betrachtungen zumeist im Vorhinein bestimmen. So kann das gewünschte Echtzeit-Verhalten erreicht werden.

 | Bernd Kärcher arbeitet im Bereich Forschung und Technologie bei Festo in Esslingen. |
- Kabellose Zukunft?
- Die systematische Produktentwicklung