Hochverfügbare Steuereinheiten entwerfen
Eine Idee zum Produkt reifen lassen (Teil 3)
Fortsetzung des Artikels von Teil 2
Langzeitverfügbarkeit - ein wichtiger Aspekt
Sind alle Hürden bzgl. Zertifizierungen, Typzulassung und Serienfreigabe genommen, muss das System auch für die nächsten 10 oder 20+ Jahre in genau der gleichen Konfiguration herstellbar sein und noch weitere Jahre mit Ersatzteilen und Reparaturen unterstützt werden können. Das Redesign einer Baugruppe oder die Änderungen an der Mechanik sollten bei einem zertifizierten System wegen ansonsten anfallender, aufwändiger Rezertifizierung des Gesamtsystems unbedingt vermieden werden.
Was sind die Gründe dafür, dass ein System nicht unverändert für die geforderte Zeitspanne gefertigt und geliefert werden kann?
Hauptgrund ist die Verfügbarkeit der elektronischen Bauteile/Komponenten aufgrund von Abkündigungen der Hersteller. Gerade im Konsum-Bereich ist es meist aus kommerziellen, aber auch aus technischen Gründen nicht unüblich, aktive Komponenten aufgrund kleinerer Prozesstechnologien und höherer Leistung bei geringeren Kosten nach zwei bis drei Jahren zu ersetzen. Dem wird, wie schon in [1] beschrieben, von Heitec dadurch vorgebeugt, dass bei der Auswahl der aktiven Komponenten auf das Vorhandensein einer „Second Source“ geachtet wird. Ist eine solche nicht vorhanden, werden nur Prozessor-Modelle verwendet, bei denen vom Hersteller eine Lebensdauer garantiert wird, die den industriellen Anforderungen entspricht.
Schon bei der Systemkonzeption und der Umsetzung der benötigten Funktionalität in Baugruppen und Komponenten wird also darauf geachtet, das Risiko eines Redesigns durch intelligente Komponentenauswahl zu minimieren. Das kann bei aktiven Komponenten bedeuten, dass die Komponentenauswahl auf die sogenannten „Embedded Roadmaps“ der Chiphersteller beschränkt wird – dabei wird vom Hersteller eine Untermenge aller verfügbaren Prozessoren auf einer „Embedded Roadmap“ mit der Garantie geführt, diese deutlich länger zu liefern, als das für die kommerziellen Prozessoren der Fall ist.
Trotzdem kann es passieren, dass Komponenten, die auf den Embedded Roadmaps der Hersteller geführt werden, in der Lebensphase des Steuersystems abgekündigt werden. Für dieses Szenario spielt das Tracking aller relevanten Bauteile in enger Zusammenarbeit mit den Herstellern eine große Rolle. Die Mitteilung bzgl. Abkündigung (Product Change Notification, PCN) muss also sehr frühzeitig und proaktiv erfolgen, um beim Systemspezialisten die Auswirkung abschätzen zu können und dann, falls dieses Bauteil nicht 1:1 ersetzbar ist, der Kunde entsprechend schnell über die Situation und mögliche Lösungsansätze informiert werden kann.
Wichtig ist in jedem Fall, dass der Kunde eine Überprüfung seiner Geschäftssituation durchführt: Wie viele Systeme/Baugruppen werden voraussichtlich noch bis wann benötigt? In vielen Fällen ist das allerdings der Blick in die Kristallkugel, da aufgrund der immer volatileren Zyklen der Weltwirtschaft solche Aussagen selten zuverlässig sein können und auch die Forecasts der Endkunden schwierig zu ermitteln sind. Gerade bei Investitionsgütern kann es also passieren, dass ältere Maschinen oder Telekommunikationsanlagen, die eigentlich nach 15 Jahren ersetzt werden sollten, in einer schlechten Wirtschaftslage durchaus noch weit länger verwendet werden.
Abhilfe- bzw. Vorsorgemaßnahmen bei Abkündigung des Prozessors
Prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten, wie die nächsten Schritte bei Abkündigung eines Prozessors aussehen können:
- Ersetzung durch einen Form-Fit-Function-kompatiblen Prozessor auf der Baugruppe. Dies erfordert entsprechendes Board-Redesign und aufwändige Regressionstests mit allen Software- und Applikationsvarianten, um ein 100 % identisches Verhalten der Systeme in allen Einsatzfällen sicherzustellen.
- Einkauf (Last Time Buy, LTB) der Anzahl der voraussichtlich benötigten Prozessoren und Produktion der Baugruppen anhand des voraussichtlichen Bedarfs der nächsten Jahre bis zum Lifecycle-Ende des Steuersystems. Dies bedeutet ein sehr hohes Anfangsinvestment, da Tausende von Baugruppen produziert, finanziert und entsprechend aufwändig mit dem Risiko gelagert werden müssen, dass entweder zu viele Baugruppen produziert und dann am Ende abgeschrieben werden müssen oder – was oftmals unterschätzt wird – dass aufgrund zu konservativer Abschätzung zu wenig Baugruppen produziert wurden und deshalb das System des Kunden trotz Bedarf auf dem Markt aufgrund nicht mehr herstellbarer Steuereinheiten abgekündigt werden muss.
- Last Time Buy nur der Komponenten, die abgekündigt werden, und dadurch die Absicherung, dass die Boards weiterhin nach Bedarf produziert werden können – im Falle des Prozessors wird aufgrund der Einschätzung des Kunden die Anzahl der Prozessoren eingekauft und speziell für den Kunden sicher gelagert. Abhängig von der Bauteile-Art kann dies z.B. auch in Stickstoff erfolgen. Damit wird sichergestellt, dass aktive Komponenten auch nach langer Lagerung 100 % funktionsfähig bleiben. Dies hat den Vorteil, dass nur das Anfangsinvestment in die Prozessoren gemacht werden muss, was nur den Bruchteil des Investments für eine komplette Baugruppe ausmacht.
Um dies zu erreichen, muss der Hersteller der Baugruppen und der Mechanik diesen Service inkl. Tracking nahtlos und flexibel unterstützen. Er muss also die Bauteile lagern, die Produktion für diese Baugruppen über Jahrzehnte aufrechterhalten und das Tracking dynamisch weiterführen – denn es kann ja durchaus passieren, dass einige Jahre später ein weiteres Bauteil abgekündigt wird und das Service-Programm für die relevante Baugruppe auf dieses Bauteil ausgeweitet werden muss.
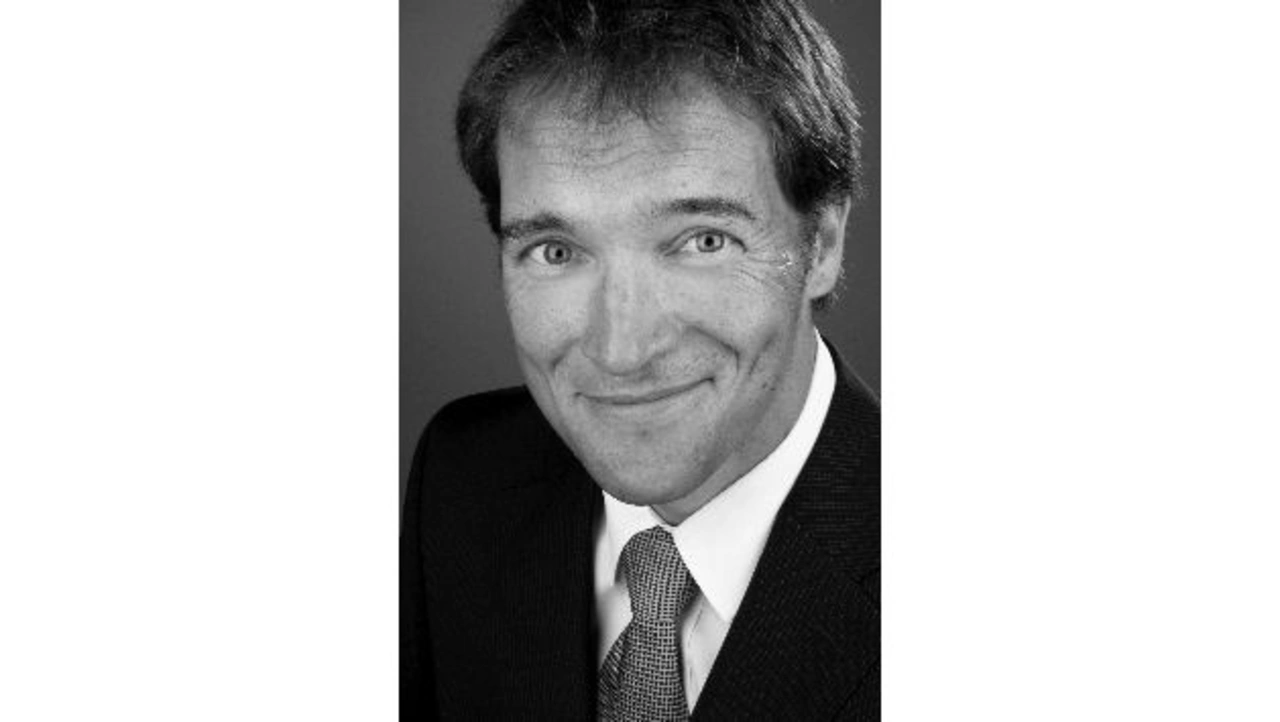
- Eine Idee zum Produkt reifen lassen (Teil 3)
- Systemfertigung und Systemintegration
- Langzeitverfügbarkeit - ein wichtiger Aspekt




